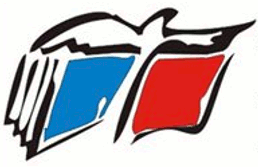
Assata Shakur – Eine Autobiographie
Auszug aus dem Nachwort
 (…) Havanna. Träge Sonne über blaugrünem Meer. Eine wunderschöne Stadt mit engen verwinkelten Gassen auf der einen Seite und breiten, von Bäumen gesäumten Alleen auf der anderen. Häuser mit abblätternder Farbe und uralte amerikanische Straßenkreuzer aus den vierziger und fünfziger Jahren.
(…) Havanna. Träge Sonne über blaugrünem Meer. Eine wunderschöne Stadt mit engen verwinkelten Gassen auf der einen Seite und breiten, von Bäumen gesäumten Alleen auf der anderen. Häuser mit abblätternder Farbe und uralte amerikanische Straßenkreuzer aus den vierziger und fünfziger Jahren.
Havanna ist eine Stadt voller Leben, überall Busse, Leute in Eile, Kinder mit hellgelben oder goldenen Uniformen, die mit hin- und herbaumelnden Schultaschen die Straßen entlangschlendern. Zuallererst fielen mir die offenen Türen auf. Wohin man auch kommt, sie stehen überall weit offen. Staunend machte ich die Erfahrung, daß es tatsächlich möglich war, nachts allein durch die Straßen zu gehen.
Alte Leute gehen mit ihren Einkaufstaschen langsam die Straßen entlang, halten an und fragen "Qué hay? Qué hay en al mercado?" "Was gibt’s denn heute auf dem Markt?" Sie rufen den Kindern wie selbstverständlich zu, sie sollen von der Straße verschwinden. Mit in die Hüften gestemmten Armen stehen sie da, als würde ihnen dies Fleckchen Erde gehören. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Sie haben keine Angst.
"Es mentira!" rufen meine Nachbarn aus. "Das ist doch gelogen!" "Qué mentirosa tu eres!" "Was für eine Lügnerin du bist!" Meine Nachbarn fragen mich, wie es in den USA ist, und sie bezichtigen mich der Lüge, wenn ich ihnen vom Hunger erzähle und von der Kälte und von den Menschen, die auf der Straße schlafen. Sie weigern sich, mir zu glauben. Wie sollte das in einem so reichen Land möglich sein? Ich erzähle ihnen von der Drogenabhängigkeit, der Kinderprostitution und der Straßenkriminalität. Sie sagen ich würde übertreiben. "Wir wissen, daß der Kapitalismus kein gutes System ist, aber du brauchst nicht zu übertreiben. Gibt es wirklich zwölfjährige Drogenabhängige?"
Auch wenn sie vom Rassismus, vom Ku Klux Klan und von der Arbeitslosigkeit wissen, so kommt ihnen das alles doch fremd und unwirklich vor. Kuba ist ein Land der Hoffnung. Die Realität der Menschen dort sieht so anders aus. Ich bin erstaunt, wieviel die Kubanerinnen und Kubaner in der kurzen Zeitspanne seit der Revolution geschafft haben. Überall stehen neue Gebäude- Schulen, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Kliniken und Kindertagesstätten. Es sind keine Wolkenkratzer, wie sie mitten in Manhattan aus dem Boden schießen. Es sind keine Häuser mit exklusiven Eigentumswohnungen oder luxuriösen Büroetagen, Diese neuen Gebäude gehören dem Volk.
Ärztliche und zahnärztliche Versorgung und Krankenhausaufenthalte sind kostenlos. Die Miete beträgt nicht mehr als zehn Prozent des Lohnes. Es werden keine Steuern erhoben, keine Lohnsteuer, keine Steuern von den Kommunen, den Ländern oder dem Bund. Es ist schon komisch, wenn man beim Einkaufen wirklich nur den Preis bezahlt, der auf der Ware steht, ohne daß noch ein Steueraufschlag draufkommt. Kino, Theater, Konzerte, Sportveranstaltungen kosten höchstens ein oder zwei Pesos. In Museen ist der Eintritt frei.
Sonnabends und sonntags sind die Straßen voller Menschen, die sich schick gemacht haben und ausgehen wollen. Ich entdecke mit Staunen, wie reich das kulturelle Leben dieser kleinen Insel ist und wie lebendig sie ist – wo doch die Presse in den USA genau das Gegenteil vermittelt.
Auf einer Party wird mir ein Mann vorgestellt. Die Gastgeberin erzählt mir, er komme aus El Salvador. Ich strecke ihm die Hand entgegen, um ihn zu begrüßen. Ein paar Sekunden zu spät bemerke ich, daß er nur noch einen Arm hat. Er fragt mich, aus welchem Land ich komme. Ich bin ganz durcheinander und schäme mich so, daß ich fast zittere. "Yo soy de los estados unidos, pero no soy yankee", sage ich. Ein Freund hatte mir diesen Satz beigebracht. Ich war jedesmal zurückgeschreckt, wenn mich jemand gefragt hatte, woher ich denn käme. Ich mochte den Leuten nicht erzählen, daß ich aus den USA kam. Am liebsten hätte ich gesagt, ich sei Neu-Afrikanerin, nur hätte kaum jemand verstanden, was das bedeutet. Als ich von den Todesschwadronen in El Salvador und von der Bombardierung nicaraguanischer Krankenhäuser las, hätte ich am liebsten laut geschrien.
Zu viele Menschen in den USA unterstützen Tod und Zerstörung, ohne sich dessen bewußt zu sein. Indirekt unterstützen sie die Ermordung von Menschen, mit deren Leichen sie sich nie werden konfrontieren müssen. Doch in Kuba konnte ich die Ergebnisse der us-amerikanischen Außenpolitik sehen: Folteropfer an Krücken, die aus anderen Ländern nach Kuba kamen, um sich behandeln zu lassen, darunter Kinder aus Namibia, die Überlebende von Massakern waren. Und ich sah die Spuren, die die hinterhältigen Angriffe der US-Regierung gegen Kuba hinterlassen hatte, zu denen Sabotage und zahlreiche Attentatsversuche auf Fidel Castro gehörten. Ich fragte mich, wie all die Menschen in den Staaten die immer gern so hart sein wollen und sagen, die USA sollten doch hier einmarschieren, da etwas bombardieren, dort die Macht übernehmen oder dies und jenes angreifen, sich wohl fühlen würden, wenn sie wüßten, daß sie indirekt dafür verantwortlich sind, daß irgendwo auf der Welt kleine Kinder verbrennen. Ich fragte mich, wie ihnen zumute sein würde, wenn sie dafür die moralische Verantwortung zu übernehmen hätten. Manchmal scheint es, als seien die Menschen in den Staaten so daran gewöhnt, den Tod hautnah in den Abendnachrichten zu sehen und zu verfolgen, wie in Afrika Menschen verhungern, in Lateinamerika zu Tode gefoltert oder in Asien auf den Straßen Niedergeschossen werden, daß die Menschen auf der anderen Seite des Ozeans – die "da unten" oder die "da oben" - für sie gar nicht zur Wirklichkeit gehören.
Eine der ersten Fragen, die Schwarze bewegt, wenn sie nach Kuba kommen, ist die, ob es dort Rassismus gibt oder nicht. Da war ich sicher keine Ausnahme. Ich hatte mich ein wenig in die Geschichte der Schwarzen in Kuba beschäftigt und wußte, daß sie anders verlaufen ist als in den USA. Der Rassismus ist in Kuba nie so gewalttätig oder institutionalisiert gewesen wie in den Staaten, und es gab dort eine weit stärkere Tradition des gemeinsamen Kampfes beider Rassen – der schwarzen und der weißen – für ihre Befreiung zunächst vom Kolonialismus, dann von der Diktatur. Kubas erster Unabhängigkeitskrieg hatte 1868 begonnen, als Carlos Mauel De-Céspedes seine Sklaven freiließ und dazu ermunterte, sich der Armee anzuschließen und gegen Spanien zu kämpfen. Eine der wichtigsten Figuren in diesem Krieg war ein Schwarzer, Antonio Maceo, der der bedeutendste Militärstratege war. In der Arbeiterbewegung Kubas in den fünfziger Jahren spielten Schwarze eine entscheidende Rolle. Jesús Menendez und Lázaro Pena waren Führer zweier Schlüsselgewerkschaften. Und ich wußte, daß Schwarze wie Juan Almeda, heute Commandante de la la Revolución, im revolutionären Kampf gegen Batista eine wichtige Rolle gespielt hatte. Mich interessierte jedoch ganz besonders, wie es den Schwarzen nach dem Triumph der Revolution ergangen war.
Während meiner ersten Wochen in Havanna lief ich viel herum und sperrte Augen und Ohren auf. Nirgendwo fand ich rassengetrennte Stadtviertel, aber etliche Leute erzählten mir, daß die Gegend, in der ich lebte, vor der Revolution rein weiß gewesen sei. Schon beim flüchtigen Betrachten wurde mir klar, daß die Beziehungen zwischen den Rassen in Kuba ganz anders waren als in den USA. Überall sah man Schwarze und Weiße zusammen – in den Autos, auf den Straßen. Die Kinder aller Rassen spielten miteinander. Es war ganz eindeutig anders hier. Immer, wenn ich jemanden traf, der oder die Englisch sprach, fragte ich gleich nach der Meinung zur Rassenfrage.
"Rassismus ist in Kuba gesetzeswidrig", wurde mir gesagt. Viele schüttelten den Kopf: "Aqui no hay racismo." "Hier gibt es keinen Rassismus." Auch wenn ich von allen die gleiche Antwort erhielt, ich blieb doch skeptisch und mißtrauisch. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß es möglich wäre, Hunderte von Jahren Rassismus in weniger als 25 Jahren zu eliminieren, einfach so. Für mich war die Revolution keine Zauberei, und kein Zauberspruch konnte über Nacht Veränderungen bringen. Ich hatte gelernt, Revolution als einen Prozeß zu begreifen. Ich gelangte schließlich zu der Überzeugung, daß die kubanische Revolution sich mit aller Kraft dafür einsetzte, alle Formen des Rassismus zu eliminieren. Es gab keine rassistischen Institutionen, Strukturen oder Organisationen, und ich lernte, daß das kubanische Wirtschaftssystem den Rassismus unterminierte und nicht förderte.
Ich hatte angenommen, daß Schwarze in der kubanischen Revolution daran arbeiten würden, die Veränderungen fest zu etablieren und die Kontinuität der nicht-rassistischen Politik zu sichern, die Fidel und die Führer der Revolution in jeden Aspekt des Lebens in Kuba eingeführt hatten. Ein schwarzer kubanischer Freund verhalf mir zu einem besseren Verständnis. Er erklärte mir, daß ihr afrikanisches Erbe für die Kubanerinnen und Kubaner eine Selbstverständlichkeit sei. seit Hunderten von Jahren würde in Kuba nach afrikanischen Rhythmen getanzt, würden traditionelle Rituale vollzogen und Gottheiten wie Shango und Ogun verehrt. Er erzählte mir, daß Fidel in einer Rede gesagt hatte: "Wir sind alle Afro-Kubaner, vom Hellsten bis zum Dunkelsten."
Ich sagte ihm, ich fände, daß es die Pflicht aller Afrikanerinnen und Afrikaner auf dieser Welt sei, darum zu kämpfen, die historischen Strukturen umzukehren, die der Imperialismus und die Sklaverei hervorgebracht hätten. Er stimmte mir zwar zu, versicherte mir aber im gleichen Atemzug, daß er sich nicht als Afrikaner verstehe. "Yo soy Cubano." "Ich bin Kubaner." Und er war offensichtlich sehr stolz darauf, Kubaner zu sein. Er erzählte mir die Geschichte eines weißen Kubaners, der zweimal als Freiwilliger nach Angola gegangen war. Für seine Heldentaten hatte er hohe Auszeichnungen erhalten. "Seine Geschichte ist überhaupt nicht typisch für Kuba, aber es gibt schon ein paar Leute, die sich nur schwer an die Veränderungen gewöhnen."
"Was war los mit ihm?" fragte ich. "Als der Typ nah Hause kam, provozierte er in seiner Familie einen Riesenskandal. Seine Tochter wollte einen Schwarzen heiraten, und er war gegen diese Ehe. Er sagte, er wolle, daß seine Enkelkinder so aussehen wie er. Es gab einen fürchterlichen Streit, die ganze Familie wurde darin verwickelt. Der Typ war so durcheinander, daß er durchdrehte, als seine Tochter ihn einen Rassisten nannte. Er wollte sich mit allen prügeln. Er lief auf die Straße, heulte und trat gegen die Straßenlaternen, Er wußte nicht, was er machen sollte. All die Jahre war er in Angola gewesen, hatte gegen den Rassismus gekämpft und hatte dabei die über seinen eigenen Rassismus nachgedacht."
Ich stimmte ihm zu, daß die Weißen, die gegen Rassismus kämpften, diesen Kampf auf zwei Ebenen führen müßten, einmal gegen den institutionalisierten Rassismus, zum anderen gegen ihre eigenen rassistischen Ansichten. "Was ist aus dem Mann geworden?" fragte ich.
"Seine Tochter hat trotzdem geheiratet, und die Familie konnte ihn überreden, zur Hochzeit zu gehen. Jetzt paßt er oft auf seine Enkelkinder auf und sagt, daß er total verrückt nach ihnen ist, aber so ganz richtig im Kopf ist er immer noch nicht. Wenn ich ihn treffe, entschuldigt er sich dauernd bei mir. Ich habe ihm gesagt, daß ich keine Entschuldigungen von ihm hören will. Soll er sich bei seiner Tochter entschuldigen oder bei ihrem Mann. Solange er die Revolution unterstützt, schere ich mich nicht um das, was er denkt. Für mich zählt, was er tut. Wenn er wirklich für die Revolution ist, wird er sich ändern. Und selbst wenn er sich nie ändert, dann werden es eben seine Kinder tun. Und seine Enkelkinder schon erst recht. Und darum geht’s mir.
Die Rassenfrage in Kuba wurde für mich noch verwirrender, weil die Kategorien andere waren. Zum einen würden die meisten weißen Kubanerinnen und Kubaner in den USA nicht einmal als Weiße gelten. Sie würden als Latinos betrachtet werden. Und es schockierte mich, daß viele Kubanerinnen und Kubaner, die für mich wie Schwarze aussahen, sich selbst nicht als Schwarze begriffen. Sie nannten sich mulattos, colorados, jabaos und hatten noch eine ganze Reihe andere Bezeichnungen für sich selbst. Scheinbar galten alle, die nicht ganz schwarz waren, als Mulatten. Als mich zum ersten Mal jemand "mulatta" nannte, war ich beleidigt, daß ich sofort einen heftigen Streit angefangen hätte, wenn ich mich hätte auf Spanisch hätte verständlich machen können.
"Yo no soy una mulatta. Yo soy una mujer negra, y orgullosa soy una mujer negra", erzählte ich allen, nachdem ich ein wenig Spanisch gelernt hatte. Ich bin keine Mulattin, ich bin eine schwarze Frau, und ich bin stolz darauf schwarz zu sein." Einige Leute verstanden, woher ich kam, doch andere meinten, ich würde um die ganze Rassenfrage zuviel Wind machen. Für sie war "mulatto" nur eine Farbe wie grün oder rot oder blau. Aber für mich stand dieses Wort für eine historische Struktur. Alle meine Assoziationen damit waren negativ. Es stand für Sklaverei und für Sklavenbesitzer, die schwarze Frauen vergewaltigen. Es stand für eine privilegierte Kaste, die die europäische Kultur und ihre Werte gelernt hatte. In einigen Ländern in der Karibik stellten die Mulatten in einem hierarchischen System mit drei Kasten die mittlere Ebene dar, die als Puffer zwischen den weißen Herrschenden und den schwarzen Massen fungierte.
Es war mir unmöglich, dieses Wort isoliert von siener Geschichte zu sehen. Es erinnert mich an einen Spruch, den ich seit meiner Kindheit immer wieder gehört hatte: "Bist du weiß, dann bist du richtig. Bist du braun, dann kannst du bleiben. Bist du schwarz, dann hau bloß ab." Mir wurde klar, daß ich mich ausführlich mit kubanischer Geschichte würde befassen müssen, wenn ich die Verhältnisse wirklich verstehen wollte. Doch ich wurde das Gefühl nicht los, daß das Ding mit den Mulatten die Kubaner daran hinderte, mit einigen Ansichten aufzuräumen, die noch aus der Sklavenzeit übriggeblieben waren.
Die "Black pride"-Bewegung war für die Schwarzen in den USA und anderen englischsprachigen Ländern sehr wichtig gewesen. Sie hatte dazu beigetragen, daß Schwarze ihr afrikanisches Erbe positiv begreifen konnten. Von einer ihr vergleichbaren "Mulatto pride"-Bewegung hatte ich nie etwas mitgekriegt, und ich konnte mir auch nicht vorstellen, was ihre Basis hätte sein können. In meinen Augen war es für alle Nachkommen von afrikanischen Frauen und Männern auf der ganzen Welt von extremer Wichtigkeit , die politischen, ökonomischen, psychologischen und gesellschaftlichen Strukturen, die durch Sklaverei und Imperialismus entstanden sind, zu bekämpfen und zu verändern.
Der Rassismus nimmt viele Gestalten an und äußert sich subtil in vielen Feinheiten und Kleinigkeiten. Er stellt ein kompliziertes Problem dar, dessen Lösung eine gründliche Analyse und einen langen Kampf erfordert. Auch wenn ich in vielen Punkten einen anderen Ansatz hatte als die Leute in Kuba, so hatte ich doch das Gefühl, daß wir dasselbe Ziel hatten: die Abschaffung des Rassismus überall auf der Welt. Ich achtete die kubanische Regierung nicht nur wegen ihrer nicht-rassistischen Prinzipien, sondern auch deshalb, weil sie dafür kämpfte, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen. (...)
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Agipa-Press
Assata Shakur
Assata - Eine Autobiographie von Assata Shakur
Atlantik-Verlag, 2003, 358 Seiten, br., 18,00 €
ISBN-10: 3-926529-44-X / ISBN-13: 978-3926529442
