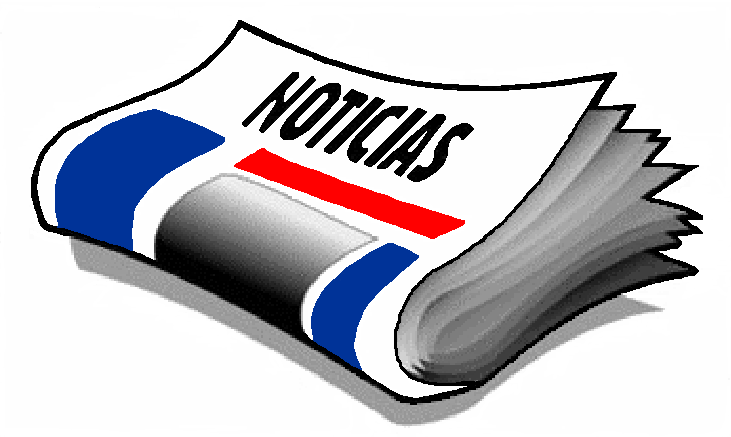
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
Verehrt und verachtet
Ein Jahr nach dem Tod von Diego Maradona: Neben den Spielkünsten gehört sein Einsatz für eine bolivarische Alternative zum Erbe des Jahrhundertfußballers.
»Heute wollen uns diese Faschisten demütigen. Sie wollen uns auf den Knien sehen, in unserem Haus, wir lassen sie nicht, wir kämpfen um jeden Ball», heizt Diego vor einem Spiel seines SSC Neapel gegen Lazio Rom die Stimmung an. Vor rund zwei Wochen schlug die Szene aus der aktuellen zehnteiligen Serie »Maradona - Leben wie im Traum» hohe Wellen. Lazio zürnte, man wolle »die Öffentlichkeit die Qualität der Maradona-Reihe von Amazon Prime beurteilen» lassen. »Die wenigen Sekunden», die der Verein kenne, seien »lächerlich», man habe Maradona »auf völlig willkürliche und unwahrscheinliche Weise Worte zugeschrieben», die er »nie ausgesprochen» habe. (mopo.de, 10.11.2021) Den Machern der Serie muss man lassen: Sie ist kurzweilig und fängt zeitpolitische Hintergründe ein. Das zeigt schon die erste Folge, in der ein jugendlicher Diego in eine Militärkontrolle gerät und Leute wie er aus den Wellblechhütten als »dreckige Peronisten« bezeichnet werden. Der Volte gegen die »Faschisten» aus Rom mag ein wenig künstlerische Freiheit anhaften, sinnentstellt ist sie nicht: Den Lazio-Fans eilt bis heute der Ruf voraus, gerne mal »Duce, Duce»-Rufe erschallen zu lassen. »Gewohnheit, faschistische Chöre anzustimmen», titelte die Süddeutsche Zeitung (4.11.2011) erst kürzlich und erinnerte an einen Vorfall vom Sommer dieses Jahres: Als »Wurm» wurde der albanische Rechtsverteidiger Elseid Hysaj begrüßt, als dieser im Juli vom SSC Neapel zu Lazio wechselte und dort zum Einstand »Bella Ciao» sang.
Mit gleicher Münze
»Drei Chorknaben« würden »genügen, um Maradona wie eine Kerze auszulöschen«, hatten sie bei Lazio getönt, als man 1985 zum Gastspiel nach Neapel reiste. Die Quittung: Diego schenkte ihnen drei Treffer ein, einer schöner als der andere. Nach dem 4:0 in der 87. Minute lief er zur Bank der Römer und zeigte dem Trainer jenen Stinkefinger, der bei der WM 2018 noch einmal für Aufregung sorgen wird. Auch bei der WM 1990 hatte er eine Antwort parat, als er mit Argentinien im Endspiel gegen Deutschland stand: »Als unsere Nationalhymne gespielt wurde, fingen sie an zu pfeifen. Und erst recht, als mein Bild auf der Riesenleinwand auftauchte«, erinnerte er sich. Seine Worte habe er darauf »ganz deutlich« mit seinen »Lippen ausgesprochen«, damit »alle es ablesen können«. Unschwer ließ sich ein »Hijos de puta« (Hurensöhne) entziffern. Er wusste mit gleicher Münze zurückzuzahlen.
Nicht immer wurde er bei den großen Vereinen mit Plakaten wie »Maradona - Hitler hat dich vergessen» empfangen, so geschehen im San-Siro-Stadion von Mailand. Doch die Schmähungen waren an der Tagesordnung, wenn Neapel im Norden auflief. Wenn sie nicht Diego persönlich galten (»Schinken mit Locken«), so dem verachteten Süden: Mit »Willkommen in Italien« empfing man die »Barfußkinder«, »Cholera-Neapel«- oder »Wascht euch«-Chöre ertönten, der Vesuv solle sie »mit Feuer waschen«. Als die Mannschaft »dank des magischen Einflusses von Maradona den besten Fußball Italiens zu spielen begann«, so der große Eduardo Galeano, »reagierte das Publikum aus dem Norden des Landes, indem es die alten Waffen der Verachtung zückte« und die »Aufsässigkeit des aufdringlichen Pöbels aus dem Süden« bestrafte. Wie kein Zweiter gab Maradona die Antwort auf dem Platz: als Dribbler und Dirigent, als einer, der Spiele alleine entscheiden konnte, oft genug spektakulär.
1984 nach Neapel gewechselt, führte er den Verein aus den Niederungen der Liga zu zwei Meisterschaften (1987, 1989) und dem Gewinn des UEFA-Cups (1989). Das »Oh mamà, mamà, mamà / ho visto Maradona&Laquo; singen sie noch heute in der Stadt: »O Mama, Mama, Mama / ich habe Maradona gesehen. / Weißt du, warum mein Herz so schlägt? / Ich habe Maradona gesehen. / Und Mama, ich bin verliebt.« Die »Liebe der Neapolitaner« sei »fast erdrückend« gewesen, so Diego einmal. Auf den Triumph folgte die Tragödie, die Flucht aus der Stadt, von Drogen gezeichnet. Die Verehrung ist bis heute ungebrochen, entscheidend dabei, wie vielfach zu hören: Er gab »dem Süden die Würde zurück«. Bei seinem Tod gab es das Bild von einem weinenden Neapolitaner, der sagte: »Er hat uns gelehrt, den Kopf hoch zu tragen.«
Verehrt und verachtet: Das war schon in Argentinien so, als er nicht zu River Plate ging, dem Bayern München Argentiniens, sondern Boca Juniors die Meisterschaft schenkte, dem »Lieblingsverein der armen Leute mit dem strähnigen Indiohaar«, verschrien als Hort von »Schwarzen, Schwulen, Bauerntrampeln« (Galeano). Bei der WM 86 wird er sich mit den Herren der FIFA anlegen (»Schon gut, trinkt euern Schampus«), als man sie in der mexikanischen Mittagssonne spielen lässt - zur besten europäischen Sendezeit. Und im Viertelfinale wird er England, die alte Kolonialmacht, an der Nase herumführen, in einem zur Revanche für den Falklandkrieg hochgeschriebenen Spiel. Für das Tor mit der »Hand Gottes« wird er keinen Grund zur Entschuldigung sehen, es sei gewesen, »als hätte ein neapolitanischer Straßenjunge einem reichen Engländer die Geldtasche gestohlen«. Doch erst in Kombination mit dem 2:0, dem Jahrhundertsolo kurz darauf, ist die Symbolik vollendet: »Die europäischen Imperien«, so John Reynolds in einem Nachruf für das Portal Africa Is a Country, »bauten auf eine doppelzüngige Kombination aus roher Gewalt und Rechtsstaatlichkeit. Maradona knipste an diesem Tag beides aus.«
Die Rolle des antikolonialen Helden, den bereits zu der Zeit viele in ihm sahen, füllte Diego selber mit Leben. 1987 wies er laut der indischen Tageszeitung The Hindu ein 100-Millionen-Dollar-Angebot der International Management Group (IMG), eines großen Players im Sportbusiness, zurück. Es hätte beinhaltet, eine doppelte Staatsangehörigkeit anzunehmen: neben der argentinischen die US-amerikanische. Ebenfalls bald nach der WM wollten ihn auf dem amerikanischen Kontinent zwei fast benachbarte Länder auszeichnen: Die USA »wollten mir einen Preis verleihen, und Kuba wollte auch«. Mit einer wenig wertschätzenden Geste erklärte er dem Filmemacher Emir Kusturica, die USA hätten »ihren Preis doch behalten« sollen, er habe den kubanischen genommen. Bereits 1987 traf Diego auf der karibischen Insel erstmals auf Fidel Castro. Erst als Spieler in Neapel setzte er sich näher mit Che Guevara auseinander: In Italien sah er dessen Konterfei plötzlich auf Fahnen, bei Demonstrationen und Streiks. Es sei »von Bedeutung«, so Diego in seiner Autobiographie, »dass das nicht in Argentinien begonnen hat; denn dort war der Che für mich das gleiche wie für die meisten meiner Landsleute: ein Mörder, ein Terrorist, ein Schurke«, einer, »der in Schulen Bomben legt«. Beide, Che und Fidel, wird Maradona mit einem Tattoo verewigen. Und er wird ihnen im Jahr 2000 auf einer FIFA-Gala zum Entsetzen der versammelten Weltpresse die Auszeichnung zum Fußballer des Jahrhunderts widmen.
Held der Armen
Vom Peronismus geprägt, stritt er fortan für eine bolivarische Alternative, für einen Weg der Unabhängigkeit Lateinamerikas. Im Einsatz für Kuba, Venezuela und Bolivien als deren Taktgeber wie auch in der Verteidigung gemäßigter Linksregierungen wie in Argentinien oder Brasilien liegt das politische Erbe Maradonas. Zusammen mit seinen Ballkünsten, für die irgendwann nur noch Begriffe aus dem Wortfeld »Gott« hinreichten, bedeutete das ein explosives Gemisch. Hier wie dort wies er über das Bestehende hinaus. Wenn er das Unmögliche auf dem Platz verwirklichte, so kann auch gelten: Seien wir doch »realistisch«, wie sich mit dem »größten Argentinier aller Zeiten« (Maradona über Che Guevara) sagen lässt, und »versuchen« auch jenseits des Platzes »das Unmögliche«. Oder, wie es Jorge Valdano, Mannschaftskollege bei der WM 86, in einem Nachruf für den britischen Guardian ausdrückte: »Infolge seiner Herkunft wuchs er mit Stolz auf seine Klasse auf. So groß war seine symbolische, ideelle Macht, dass mit Maradona die Armen die Reichen besiegten und die bedingungslose Unterstützung, die von unten kam, proportional zum Misstrauen von oben war. Die Reichen hassen es zu verlieren. Aber am Ende waren selbst seine größten Feinde gezwungen, sich vor ihm zu verbeugen. Sie hatten keine andere Wahl.»
Den »Stolz auf seine Klasse« mag verstehen, wer nach Villa Fiorito blickt, auf jenes Elendsviertel von Buenos Aires, aus dem Diego stammt. Für immer schrieben sich ihm die sozialen Widersprüche ein, zeit seines Lebens wird er jene verteidigen, aus deren Mitte er kam. Wo Diego aufwuchs, gab es diese staubige Brachfläche, auf der er unentwegt spielte, sich durchzusetzen lernte. Die frühen Finten und Haken trug der »Pibe de oro«, der »Goldjunge«, bald in die Welt. Noch mit seiner Spielweise verkörperte er den Süden: Er stand in der Tradition der »kreolischen« Spielweise, der das Bild vom »maschinellen« britischen Fußball entgegenstand. In dem Jahrhundertsolo zum 2:0 gegen England bei der WM 86 spiegelte sich das »improvisierte und nicht reglementierte Spiel in den Hinterhöfen und Plätzen von Buenos Aires«, so der argentinische Sozialanthropologe Eduardo Archetti. Von dort habe er die »kreative Freiheit, den Mut und die Frechheit im Naturell eines Pibe« mitgenommen. In einem Beitrag von 2021 sprachen die Journalisten Tobias Escher und Lukas Tank von Diegos »Straßenschlag«, die heutigen Jugendakademien würden derlei »Ecken und Kanten abschleifen«. In den 1990ern sollte Maradona zusammen mit anderen großen Spielern wie Eric Cantona eine Spielergewerkschaft gründen.
Symptomatisch für das intuitive Bewusstsein Maradonas ist die Sache mit dem Trikot, eine Geschichte von 1979, die - unter Bezug auf die argentinische Zeitung Nuestra Propuesta - im deutschsprachigen Raum erst 2020 durch einen Nachruf von Günter Pohl in der Wochenzeitung Unsere Zeit bekannt wurde. Es war die Zeit der Militärdiktatur (1976–83), einer der härtesten in Lateinamerika, rund 30.000 »Verschwundene« zeugen davon. Und es war ein Jahr nach der WM in Argentinien, zu deren Schlaglichtern gehören: auf der Tribüne und in der Kabine ein Henry Kissinger, der als US-Außenminister in den Staatsstreich involviert war, wie schon im Fall Chiles; ein DFB, der entsprechend der bundesdeutschen Politik großes Verständnis für die Politik der Junta hatte, samt einem Kapitän, der ein Land sah, »in dem Ordnung herrscht« (Hans-Hubert »Berti« Vogts); aber auch: eine Protestkampagne, die in Westdeutschland unter dem Slogan »Fußball ja, Folter nein« auftrat; und mit César Luis Menotti ein argentinischer Nationaltrainer, der nach dem Finalsieg den Generälen den Handschlag verweigerte, seine Spieler hätten »die Diktatur der Taktik und den Terror der Systeme besiegt«. Bereits vor der WM hatte ein 16jähriger Diego sein Länderspieldebüt gefeiert, Menotti nahm ihn für das Turnier aber nicht in den Kader, um das Jahrhunderttalent zu schonen. Dafür wurde Maradona 1979 Juniorenweltmeister, ebenfalls unter Menotti, von dem offenbar auch politisch etwas auf den Schützling abfärbte. Im Präsidentenpalast wurden die frischgebackenen Juniorenweltmeister empfangen, die Junta bekam die gewünschten Bilder. Und was macht Diego anschließend? Er verschenkte »auf Bitten der Schwester eines politischen Gefangenen sein Trikot mit Widmung an das Opfer genau der Politik, die Diego zeit seines Lebens verabscheute. Auf die Vorhaltung, wieso er sich denn damit ärger einhandeln wolle, fragte der Achtzehnjährige zurück, warum er das denn nicht machen sollte.« (UZ, 4.12.2020)
Gut 30 Jahre später wird Maradona als argentinischer Nationaltrainer am Rande der WM in Südafrika 2010 die Vorsitzende der Großmütter der Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Wie die »Madres« (Mütter), so setzten sich auch die »Großmütter« dafür ein, dass das Schicksal der Verschwundenen, der Kinder und Enkel, aufgeklärt würde. Noch einmal zehn Jahre darauf werden sich die »Großmütter« in einem Nachruf von einem »Diego des Volkes« verabschieden, »der die Ungerechtigkeiten und die Schmerzen von so vielen wiedergutgemacht hat«, von einem »solidarischen Diego, der die Wahrheit aussprach, egal was die Konsequenzen waren«.
Ein wenig Pathos durfte sein: Der argentinische Illustrator Diegolan Dibujos, der Maradona lange Zeit mit den Waffen von Stift und Pinsel begleitete, sprach von Diego als einem »Bannerträger aller, die von unten kämpfen. Der Engagierten, Bescheidenen, der Barrios, des Fortschritts und derjenigen, die nie vergessen, wo sie herkommen.« Was die Herkunft anbelangt, die sie ihm »nie verziehen«, so er selbst einmal, so waren er und seinesgleichen verrufen als »Cabecita negra«, ein Begriff, den er stolz wendete: Ja, er sei ein »Schwarzkopf«.
Die Intuition, die er am Ball zeigte, spiegelte sich in seinem sozialen Bewusstsein. 1983 - da spielte er für Barcelona und musste nach einem brutalen Foul pausieren, was er teilweise in Buenos Aires tat - führte Maradona ein Gespräch mit einem Journalisten: »¡Mago!« - »¿Me dice a mí?« entspann sich der Dialog: »Magier!« - »Sagen Sie das zu mir?« - »Ja, zu Ihnen, Sie sind ein Magier.« - »Nein, da irren Sie. Ich bin Diego.« - »Ja, der Magier Diego.« - »Nein: Diego, das ist der, der aus Villa Fiorito stammt. Die Magier leben dort, in Fiorito. Das sind die Magier.« - »Sind das Spieler?« - »Nein, hören Sie doch, sie sind Magier, weil sie von 1.000 Pesos im Monat leben.«
Von den Medien verfemt
Dank dieser Haltung gelang es den Betuchten nicht, ihn einzufangen. »Dieselben Medien«, merkte der argentinische Historiker Tomás Bartoletti in der Schweizer Wochenzeitung an, die ihn »als Champion in den Himmel loben sollten, sprachen von der internationalen Schande, die dieser ›Drogensüchtige‹ darstelle. Hinter solchen Angriffen war der Klassenhass zu erkennen, den beliebte Persönlichkeiten wie Maradona (…) hervorriefen. Da sie aus marginalisierten Schichten stammten, verzieh ihnen die Elite von Buenos Aires nie, dass sie die breite Bevölkerung begeisterten und weltweit als Ikonen Argentiniens galten.« Was »die Oberschicht nicht akzeptieren« konnte: »Mochte er noch so ein guter Spieler und noch so reich sein, er war und blieb einer aus dem Elendsviertel.«
Sie verfemten ihn, sie stellten ihm nach. Zu den unwürdigsten Schauspielen gehörte eine Sendung im italienischen Fernsehen. Zu der ersten Meistersaison in Neapel gehört die Sache mit der ungeklärten Vaterschaft. Der Fernsehsender RAI bemühte sich um Aufklärung: »Was liegt also näher«, kommentiert eine Arte-Dokumentation, »als unter immensen Kosten auf einer Studiobühne einen Lügendetektor aufzubauen und einen CIA-Spezialisten Maradonas angebliche Geliebte Cristiana Sinagra befragen zu lassen?« Mit »Befragungen« kennt sich der Dienst aus. »Als das Kind gezeugt wurde, haben Sie Maradona da gesagt, dass Sie einen Eisprung haben könnten?« - »Ja«, antwortet eine ruhige Sinagra, verkabelt mit einer Maschine, um Nervenfrequenzen aufzuzeichnen. »Ist Diego Armando Maradona der Vater Ihres Kindes?« - »Sí«, und am Ende weiß der CIA-Mann: »Sie hat die Frage bejaht, und sie hat die Wahrheit gesagt.« Der Moderator spricht von einem »großen Fußballer«, der »als Mann aber diskussionswürdig« sei. Was er bereits am Abend wusste: »Morgen wird man lesen können: Elend und Edelmut eines Champions.«
Man muss es nicht begrüßen, dass Maradona einst, von Papparazzi belagert, zum Luftgewehr griff, man verwechsle nur nicht Ursache und Wirkung. Ein paar Jahre später folgte die Medienschelte bei Gelegenheiten wie der von 2005, als er an der Seite der Präsidenten Venezuelas und Boliviens, Chávez und Morales, gegen den damaligen US-Präsidenten demonstrierte. »Sie verachten uns«, hielt er George W. Bush den verbalen Stinkefinger entgegen. Ein »Phänomen wie Diego Maradona«, so die New York Times, könne man mit dem Bestseller »Guide to the perfect Latin American idiot« (Leitfaden zum perfekten lateinamerikanischen Idioten) verstehen. Wer will, kann in solchem Gerede die mediale Begleitmusik zu realen Bedrohungen sehen. Doch Diego bot auch Schutz. Am Rande der Proteste gab es eine Szene, die André Scheer unter Rückgriff auf den Sender Telesur festhielt: Mit wem er da telefoniert habe, fragte Hugo Chávez. »Mit Fidel.« - »Und was hat er gesagt?« - »Bleib an der Seite von Chávez.« Er stehe gerade neben ihm, so Diego. »Gut«, so Castro, »dann lass ihn nicht alleine.« Was zur Mobilisierung zu den Protesten beigetragen hatte: Nicht lange zuvor hatte Maradona im Rahmen seiner Show »La noche del 10« (Die Nacht der Zehn) Castro zur besten Sendezeit auf Canal 13 im argentinischen Fernsehen interviewt - die Ausgabe wurde als »Diego y Fidel« bekannt.
Pro Maduro
Im Norden - oder besser: im Westen - traten tonangebende Medien anlässlich Maradonas Tod noch einmal nach. Während sich britische Medien wegen der »Hand Gottes» noch immer nachtragend zeigten, sprachen andere vom »politischen Delirium«, in dem Diego »versank« (FAZ, 28.11.2020). Die Neue Zürcher Zeitung kombinierte das Bild vom ungezogenen Süden mit politischer Verunglimpfung: »Mit ein wenig mehr Disziplin und Ernsthaftigkeit hätten Maradona und Argentinien mehr aus sich machen können. Er lief ohne ideologischen Kompass durch die Welt, suchte aber stets die Nähe zur Macht.« Wo war derlei Kritik eigentlich bei Sportempfängen des Weißen Hauses, bei einer Kanzlerin in der Kabine der »Jungs«, bei ungezählten Bildern aus den Ehrenlogen der westlichen Arenen? Eine derartige »Behauptung ist nachgerade grotesk«, kommentierte Gunda Wienke, Journalistin und Regionalwissenschaftlerin für Lateinamerika, den NZZ-Bericht. Denn »Maradonas ›Kompass‹ war klar gesetzt: Er unterstützte die Schwachen, die ohne Stimme.« (Amerika 21, 28.11.2020) Die Verleumdungen gegen Maradona galten stets auch einem ungezogenen Süden. Laut Spiegel, der zu Diegos Tod eine Titelgeschichte brachte, habe dieser »nicht davor zurückgeschreckt«, sich »mit Nicolás Maduro zu zeigen, dem Nachfolger des verstorbenen Chávez in Venezuela, der sein Volk hungern lässt.« (28.11.2020) Zu solcherart Ächtung hat André Scheer in einem Beitrag zum »Chavista Maradona« das Nötige gesagt.
An der Haltung der tonangebenden Medien hat sich kaum etwas geändert: dem sensationellen Fußballer die Ehre erweisen und zugleich vermeintliche »Irrwege« bekritteln. Und sich auf die wenigen Neuigkeiten und mancherlei Vermutung stürzen. Was im Jahr eins nach Maradona zu berichten war: Wegen der »rätselhaften Umstände« seines Todes stehen »sieben Ärzte und Pfleger« wegen »fahrlässiger Tötung vor Gericht« (Spiegel online, 19.11.2021). Das Geburtshaus wurde zur nationalen Gedenkstätte erklärt. In Neapel wurde, klar, das Stadion umbenannt. Zum Jahrestag erweist der SSC mit einem Sondertrikot seinem größten Sohn die Ehre. Wie weit das Fußballbusiness auf den Hund gekommen ist, zeigt eine andere Nachricht: Am 14. Dezember spielen der FC Barcelona, Maradonas unglückliche Vereinsstation, und Boca Juniors in Riad (Saudi-Arabien) den neu ins Leben gerufenen »Maradona Cup« aus. »Kinder verscherbeln das Erbe«, weiß unterdessen Bild zu berichten. Und was nicht alles versteigert wird - vom BMW »M4« oder »750i« bis hin zu einer verfallenen Villa –, um die Schulden zu begleichen, die er hinterließ.
Irrwege und Fehler
Was schwerer wog, war die auf etlichen Kanälen gleichlautende Überschrift »Ermittlungen wegen Menschenhandels gegen Maradona-Umfeld«. Inwieweit er in etwaige Machenschaften selbst verstrickt war? So der Tenor. Nun, kann sein oder nicht sein. Fest steht: Wer sich wie Maradona zeitweilig im Dunstkreis der Mafia bewegte, lässt sich auch mit Prostitution in Verbindung bringen. Oft genug nahm der Boulevard die Spur zu Schönheitsköniginnen und Puffmüttern auf, zu echten oder vermeintlichen oder vermeintlich unechten Zeugen. Es war eine Zeit, die Maradona später selbst am meisten bereute. »Wenn jemand Irrwege geht, kann der Fußball nichts dafür«, sagte er bei seiner Abschiedsrede in der »Pralinenschachtel«, dem Stadion von Boca Junior. »Ich habe Fehler gemacht und dafür gezahlt, aber das kann dem Fußball nichts anhaben.« Weiter kam er nicht, vom Moment überwältigt, die Stimme tränenerstickt.
Und doch, Maradona und die Frauen: Das blieb eine offene Flanke. Zwar gibt es gerade in den »sozialen Medien« etliche Vorhaltungen ohne weitere Belege. Doch in den 2010er Jahren tauchte ein Video auf, das von Handgreiflichkeiten zeugt. Feministische Kreise in Argentinien sind gespalten: Die einen sagen, das sei grundsätzlich nicht entschuldbar. Die anderen wollen zwar konkrete Verfehlungen nicht entschuldigen, sehen Maradona aber auch als Opfer eines patriarchalen Systems. Angerechnet wird ihm, dass er den langen Kampf gegen ein Abtreibungsverbot unterstützte, das auf jenen Schichten lastete, aus denen er selbst kam. Hilfreich zur Einordnung ist einmal mehr der Nachruf des Portals Africa Is a Country, das Maradona eben noch aufs antikoloniale Schild hob. Es gebe »Übergriffe, die kein größerer Zusammenhang rechtfertigen kann«. Der »Vorwurf der Gewalt gegen seine Freundin Rocío Oliva lässt sich mit seinem umfassenderen Vermächtnis nicht in Einklang bringen.«
Neben dem »Zauber« am Ball liegt Diegos Vermächtnis im Einsatz für eine Welt frei von kolonialen Abhängigkeiten, frei von Armut, Unterdrückung, Krieg. Darin ist auch der mediale Furor zu suchen - nicht in Spekulationen über ein »Umfeld«, über tatsächliche oder vermeintliche Vertrauensleute und deren Verstrickung in Menschenhandel. Jenseits aller persönlichen Fehltritte: Es wäre, ob Ironie oder nicht, eine Welt auch frei von Menschenhandel.
Mit dem 25. November sollte Diego und Fidel auch noch der Todestag einen. »Ein doppelt schmerzhafter Tag«, sagte der kubanische Staatspräsident Miguel Díaz-Canel im Herbst 2020 über zwei »Freunde auch in der Ewigkeit«. Während andere Maradona irrwitzig als »Antiamerikaner« verunglimpften, trauerte Maduro um den »Jungen Amerikas«. Für Morales war er schlicht der »Bruder«. »Ja, ich bin links, von Kopf bis Fuß, im Glauben. Aber nicht so, wie ihr in Europa das definiert«, sagte Maradona selbst einmal. Hasta siempre, Diego.
Glenn Jäger: Diego Maradona. In den Farben des Südens. Mit einem Beitrag von André Scheer, Köln 2021, 263 Seiten 16,90 Euro
|
Veröffentlichung |
Glenn Jäger
junge Welt, 25.11.2021