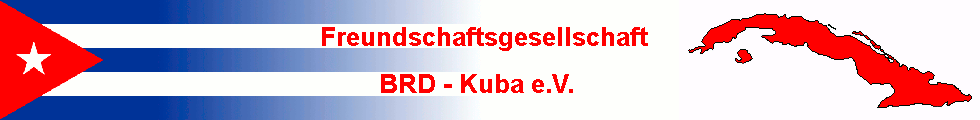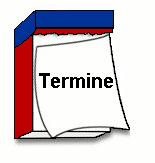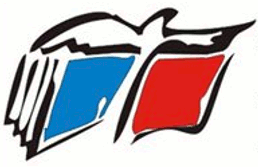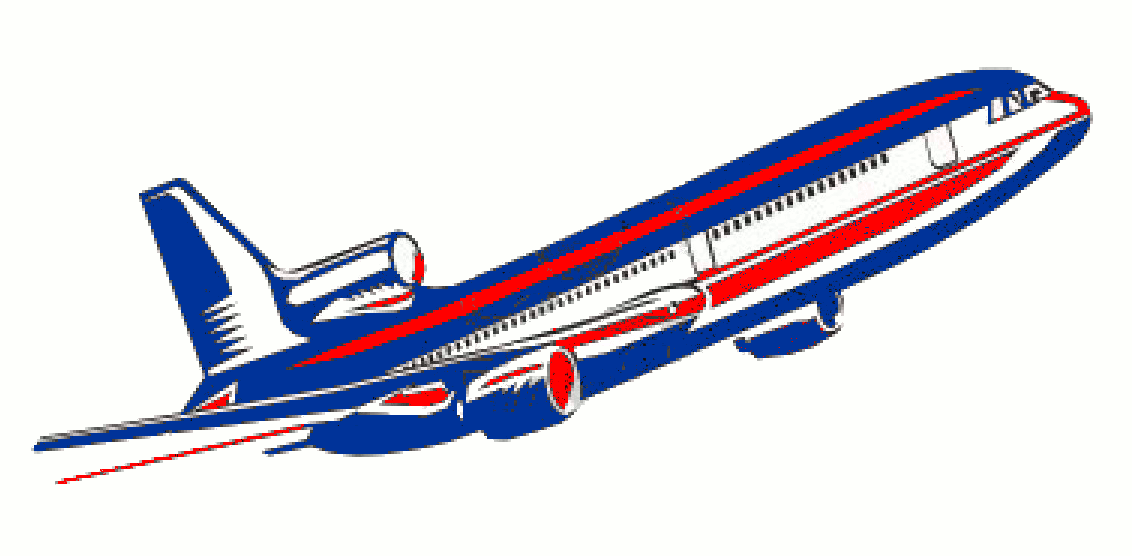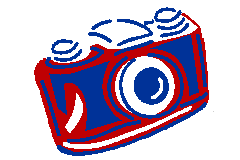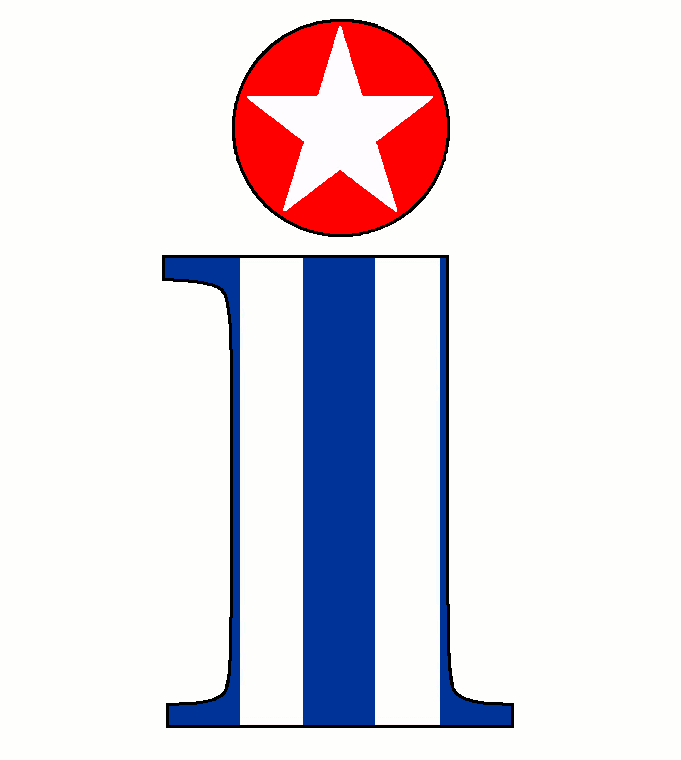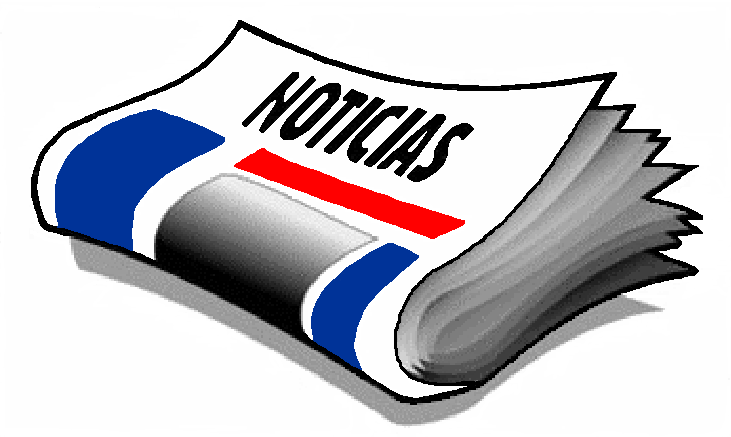
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
Kaum wiederzuerkennen
Vorabdruck – Besuch nach langer Zeit. Eine Reportage über das sozialistische Kuba aus dem Jahr 1987
Anfang April erscheint in der Berliner Edition Tiamat der zweite Band der Reportagen der legendären Journalistin Martha Gellhorn (1908-1998)). Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags eine 1987 verfasste Reportage über Kuba (»Wiedersehen mit Kuba«). Gellhorn lebte dort zwischen 1940 und 1945, unterbrochen von zahlreichen Auslandsreisen, gemeinsam mit ihrem zeitweiligen Ehemann Ernest Hemingway. (jW)

Als Martha Gellhorn nach langer Zeit wieder Kuba besuchte, stellte sie vor allem eines fest: Nach der Revolution war eine Gesellschaft ohne Angst entstanden (Jugendliche am Malecón in Havanna)
Foto: picture alliance / Klaus Rose
Am ersten Morgen in Havanna stand ich an der Ufermauer am Malecon und fühlte mich wehmütig vor Heimweh nach dieser Stadt wie eine Exilantin, die zurückkehrt – und lächerlich. Ich verließ Kuba vor einundvierzig Jahren, vermisste es nie und erinnerte mich kaum noch daran. Eine lange Amnesie hat mich das Licht, die Farbe des Meeres und des Himmels, die Menschen und den Charme des Ortes vergessen lassen.
Der Malecon ist ein Juwel des 19. Jahrhunderts – und ein Witz. Über seinen Arkaden erheben sich kleine Villen drei Stockwerke hoch, jedes Haus ist völlig verschieden von dem nächsten: mit Gipsrosen bekränzte Fenster, maurische Spitzbogenfenster mit buntem Glas, Karyatiden, schmiedeeiserne Balkone und mit Nägeln beschlagene, geschnitzte große Türen. Die Farbe an den Steingebäuden ist zu Pastell verblasst, eine spukhafte Erinnerung an die frühere Leuchtkraft: Rosa mit Violett, Blau mit Gelb oder Grün mit Kobaltblau. Wer auch immer hier wohnte, als Kuba von 1939 bis Mai 1944 mein Zuhause war, war längst fortgegangen; flatternde Wäsche deutete darauf hin, dass die reichen Privathäuser jetzt Mehrfamilienhäuser waren.
Alles verwandelt
Calle Obispo, mein früheres Revier für Haushaltswaren, war in eine Fußgängerzone verwandelt worden. Es gab kaum Polizisten in Havanna, nur an einer der Querstraßen sah ich einige, die versuchten, einen Stau aus Lastwagen, Motorrädern und hupenden Autos zu entwirren. Eine Überraschung waren die Läden: Bikinis und Kosmetika, schicke Schuhe, Schmuck, ein Geschenkartikelladen mit Porzellan und Glasschmuck. Keine Haute Couture, aber frivol. Und viele Buchläden, eine echte Neuigkeit; ich erinnerte mich an keinen einzigen. Und eine Nachbarschaftsklinik.
Die Gesichter sahen im Gegensatz zu den meisten Stadtgesichtern bemerkenswert fröhlich aus, und die Straße war erfüllt von Geplapper und Gelächter. Männer trafen Frauen, küssten sie auf die Wange, redeten und gingen weiter. Dieses öffentliche freundliche Wangenküssen erstaunte mich; ich hatte es in keinem lateinamerikanischen Land gesehen und zu meiner Zeit hier auch nie. Die meisten Frauen trugen Hosen aus einem Stretchmaterial, das, glaube ich, Trevira heißt; und viele waren üppig gebaut. Ihre enganliegenden Hosen waren lavendelblau, scharlachrot, smaragdgrün oder gelb, darüber Blusen aus geblümtem Nylon. Die jungen Leute trugen Jeans und T-Shirts mit Aufdrucken von Mickey Mouse, A big heart and luv, University of Michigan. Geschenke von Verwandten in den USA? Erwachsene Männer trugen lange Hosen aus leichtem grauen oder braunen Material und weiße Hemden. Diese Menschen waren viel besser gekleidet als durchschnittliche Kubaner zuvor und viel besser ernährt.
Am Ende dieser Straße verkaufte damals Salomon, ein tuberkulöser, sehr kleiner Mann unbestimmten Alters, aber mit großer Vitalität, Lotterielose. Salomon war Kommunist und lebte mit der Gewissheit einer glorreichen kommunistischen Zukunft, in der jeder viel zu essen hätte und seinen Unterhalt mit nützlicher Arbeit verdienen würde. An ihn erinnerte ich mich plötzlich und hoffte von ganzem Herzen, dass er noch lebte, um seinen Traum verwirklicht zu sehen, bezweifelte es aber; Salomon sah damals nicht so aus, als ob er noch fünfzehn Jahre (bis 1959, jW) leben würde, bis es soweit war.
Ich wohnte im Hotel Deauville an der Uferpromenade, ein Schandfleck aus der Zeit nach dem Krieg und vor der Revolution. Es ist ein pflaumenfarbener Betonturm im Bauhausstil. Bald schon schwärmte ich für das hässliche Deauville wegen seines Personals, das witzig war und freundlich zueinander und zu den Gästen. Wie alle Touristenhotels hat das Deauville einen Duty-free-Shop. Touristen aller Nationalitäten zahlen mit Dollar. Man bekommt das Wechselgeld, selbst die kleinen Münzen, in amerikanischer Währung. Aus praktischen Gründen entspricht ein Dollar einem kubanischen Peso, eine Parallelökonomie für Einheimische und Touristen. Präsident Reagan hat das permanente Wirtschaftsembargo der USA auf Personen ausgedehnt. Kuba ist für amerikanische Touristen tabu. Aber in jenem Jahr, 1985, kamen 200.000 kapitalistische Touristen aus Kanada, Europa, Mexiko und Südamerika, desinteressiert am Kommunismus oder unerschrocken, um einen sehr billigen karibischen Urlaub zu verbringen.
Im Deauville sah ich zum ersten Mal den amüsanten, sparsamen nationalen Minirock: die kniefreie Uniform für weibliche Angestellte, verschiedene Farben für verschiedene Berufe. Ich ließ mich auch auf die landesweite Gewohnheit ein, jeden beim Vornamen zu nennen, beginnend mit Fidel, der nie anders als Fidel genannt wird. Anfangs war ich etwas gereizt, von allen »Marta« genannt zu werden, und ständig mit dem intimen »tu« angesprochen zu werden statt mit der verschwindenden Höflichkeitsform »usted«. Aber ich passte mich schnell an und sprach Fremde als »Compañero« oder »Compañera« an. Man kann nicht »Comrad« (amerikanisch) oder »Comraid« (britisch) sagen, ohne sich albern zu fühlen, aber »Compañero« klingt so angenehm wie Gefährte.
Ich wollte mich auf den Weg machen. Ich war nicht nach Kuba gekommen, um den Kommunismus zu studieren, sondern um zu schnorcheln. In der kubanischen Botschaft in London hatte ich einige Touristenbroschüren mit der Beschreibung eines glamourösen neuen Hotels in Puerto Escondido gefunden, die das Zauberwort Schnorcheln enthielt. Ich musste in einer ernsten Angelegenheit nach Nicaragua und wollte mir en route zwei Wochen hauptsächlich in den herrlichen türkisfarbenen Untiefen vor der kubanischen Küste gönnen. Ein paar Tage in Havanna, um meiner fernen Vergangenheit wiederzubegegnen, dann Sonne, Schnorcheln, Thrillerlektüre, Rum-Drinks: mein Winterurlaub.
Am Morgen war die See grünlich schwarz und passte zum dunklen Himmel. Wellen schlugen über die Uferpromenade, die für den Verkehr geschlossen war, und spülten Sand und Kieselsteine in die Gassen. Der Wind hatte Sturmstärke; es regnete. Ein gigantischer Sturm und kein Ende in Sicht. Mir war kalt, und ich versank in einer Reiseverzweiflung, erlitt einen akuten Anfall von Langeweile. Ohne Begeisterung versuchte ich, die Zeit zu überbrücken, traf Menschen und guckte mir Sehenswürdigkeiten an, bis der Sturm aufhörte.
Rassismus verboten
Ich redete mit einer hochangesehenen afrokubanischen Dichterin in der überfüllten Lobby des Hotels Nacional de Cuba, ein altes Viersternehotel. Plötzlich gab sie angewidert ein Geräusch von sich und rief aus: »Ich hasse dieses dumme, veraltete Zeug.« Sie sprach perfekt Amerikanisch. Das Objekt ihrer Empörung war eine Hochzeitsgesellschaft: die Braut in weißem Schleier, der Bräutigam im Smoking, Blumenmädchen, Brautjungfern, strahlende Eltern und Gäste, die zum Hochzeitsempfang aufbrachen. Ich war erfreut, dass das Althergebrachte von denen, die es wollten, frei praktiziert werden konnte.
Ich hatte eine wichtige Frage an sie, war aber unsicher. »Etwas wundert mich«, sagte ich. »Fidel erließ ein Dekret oder was auch immer, sobald die Revolution begann, und verbot jede rassistische Diskriminierung. Er sagte, damit sei es nun vorbei; das gebe es nun nicht mehr. Und so ist es ja wohl auch. Das ist doch erstaunlich?« Gewiss. Und noch erstaunlicher, es scheint zu funktionieren. Sie erwiderte: »Natürlich kann man nicht die Vorurteile der Menschen per Gesetz ändern; man kann nicht ändern, was sie in ihren Herzen fühlen. Aber man kann jede rassistische Tat verbieten und bestrafen. Wir hoffen, dass die Vorurteile verschwinden, wenn wir enger zusammenleben und uns immer besser als menschliche Wesen kennenlernen.«
Es interessierte mich, wie Schriftsteller jetzt ihren Lebensunterhalt verdienen. Wie bei uns können sehr wenige der 600 Mitglieder des kubanischen Schriftstellerverbandes von ihren Büchern leben. Es gibt viele Verlage, die dem Staat gehören, aber von unabhängigen Mitarbeitern für eine vielfältige Öffentlichkeit gemanagt werden. Man reicht sein Manuskript ein; wird es angenommen, bekommt man sechzig Prozent des Ladenpreises der ersten Auflage, egal ob sich das Buch verkauft oder nicht; und vierzig Prozent für jede weitere Auflage. Kubaner lieben Lyrik, daher gibt es zahlreiche Dichter, und sie werden viel gelesen.
Ich fuhr in Havanna herum, besichtigte mit mäßiger Neugierde Sehenswürdigkeiten und fluchte über das schlechte Wetter. Ich plauderte mit Leuten in dem schmuddeligen Hauptmarkt, wo am Spielzeugstand und an der Fleisch- und Gemüsetheke am meisten los war. Ich fragte in dem überfüllten Bahnhof nach Fahrpreisen und erfuhr, dass der Schnellzug zum anderen Ende der Insel zehn Dollar 50 Cent kostet. Ich schlenderte durch das moderne Stadtviertel Vedado mit den großen Hotels, Büros der Fluggesellschaften, Läden, Restaurants, Kinos und den eindrucksvollen edwardianischen Häusern. Ich schaute mir die Villen von Miramar an. Die geflüchteten reichen Kubaner hinterließen mit ihren prachtvollen Bauten und stilvollen Apartmenthäusern der Revolution ein großzügiges Geschenk. Die großen Häuser sind nun Kliniken, Kindergärten und Clubs für die Gewerkschaften, und was keinen öffentlichen Nutzen hat, wird zur Deckung des privaten Wohnraumbedarfs genutzt.
Ich ging zu Rosa im Ministerium für Tourismus, mein einziger Kontakt mit der kubanischen Regierung, um mit ihr die Transportmöglichkeit der Reise in das kubanische Hinterland zu besprechen. Rosa ist klein, brünett, sehr hübsch, sehr klug und freundlich und geduldig über ihre berufliche Pflicht hinaus. Mein Benehmen ihr gegenüber war abscheulich, sie verdiente es in keiner Weise. Ich war rücksichtslos entschlossen, mir von niemandem etwas sagen oder zeigen zu lassen; ich würde selbst sehen und mich durchfragen. Rosa stellte Rafael als meinen Fahrer ab. Rafael ist grauhaarig, Mitte Vierzig, übergewichtig, geplagt von einem Raucherhusten, intelligent und ein Charmeur. Wir tranken viel köstliches eiskaltes kubanisches Bier, und er lachte über meine respektlosen Witze.
Rafaels Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie die Revolution das Leben der Kubaner verändert hat. Seine Frau arbeitet als Buchhalterin in irgendeinem Ministerium. Rafael ist ein Funktionär der Fahrergewerkschaft und verhandelt im Namen ihrer Mitglieder mit anderen Ministerien. »Wer zuerst nach Hause kommt, kocht das Essen.« Einer seiner Söhne studiert Englisch an der Universität von Havanna. Ein zweiter leistet, da er sein Examen nicht bestanden hat, Militärdienst und hofft, danach einen Platz an der Medizinschule zu bekommen. Rafael bezahlt monatlich umgerechnet fünfunddreißig Dollar Miete für ein Apartment in Vedado, dem früheren schicken Stadtteil von Havanna, und bald wird es ihm gehören. Die Mieten werden Jahr für Jahr verbucht, bis die Wohnung schließlich abbezahlt ist, worauf – sieh an! – man selbst ein kapitalistischer Eigentümer alten Stils wird. Mrs. Thatchers Vision einer Gesellschaft von Eigenheimbesitzern wird im kommunistischen Kuba Wirklichkeit.
Abgedroschen, aber wahr
Rafael ließ mich völlig allein, wo immer wir auch hielten. Ich übernachtete in mehreren luxuriösen Hotels; sie waren das Erbe der Mafia an den kubanischen Tourismus. Diese Hotels wurden mit Mafiageldern gebaut, weil sie Kasinos beherbergten, die nun geschlossen waren. Für mich war das alles neu; ich war nie daran interessiert, durch Kuba zu reisen, als ich noch hier lebte, und hatte keine Vorstellung von der Größe des Landes – 730 Meilen lang und im Durchschnitt 50 Meilen breit – oder von der Vielfalt der Städte und der Landschaft. Wir fuhren, ohne vorher vereinbarten Plan, wo auch immer ich hinwollte, und legten in dem knochenbrechenden Lada 1.500 Meilen zurück, und dennoch bekam ich nur einen unvollständigen Eindruck von etwa einem Drittel der Insel. Unser erster Halt war Trinidad.
Trinidad ist eine Schönheit; Kubaner sind sehr stolz darauf. Es ist eine unverändert gebliebene Kolonialstadt, das meiste stammt aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, gegründet wurde sie im 16. Jahrhundert. Die Straßen sind aus Kopfsteinpflaster, die Häuser sind einstöckig mit schönen riesigen Holztoren, breit genug für Kutschen, und Eisengitterwerk an den Vorderfenstern. Jedes Haus ist gestrichen, und Farbe macht den Unterschied – blassgrün, rosa, blau und gelb. Die Kathedrale über der Stadt ist gelb mit weißen Streifen und liegt an einem blumengeschmückten Platz, der in Stufen zu den Häusern hinabsteigt.
Das Museo Historico war im 19. Jahrhundert das Zuhause eines Zuckerbarons. Die Aufseherin, ein bezauberndes, etwa zwanzigjähriges Mädchen mit blondem Pferdeschwanz, trug die Museumsuniform, ein makellos weißes Hemd, ein dunkelblaues Jackett und einen Minirock. »Er hatte dreißig Sklaven«, erzählte sie. »Dreißig. Sie wohnten in einem großen Raum hinter dem Haus.« Die Vorstellung von Sklaven entsetzte sie. Schon als sie die Centavos für den Eintritt kassierte, belehrte sie mich: »Kuba war drei Jahrhunderte unter spanischer Herrschaft, bis 1899. Danach kam es unter amerikanische Herrschaft bis 1959.« Es klang anfangs abgedroschen und abschreckend, die reine Parteilinie, bis ich darüber nachdachte und entschied, dass es stimmte, egal wie es klang.
Tatsächlich herrschten die USA zweimal über Kuba, und die Marine war unter Berufung auf die Monroe-Doktrin (1823 verabschiedete Leitlinie der US-Außenpolitik, die sich gegen den Einfluss der europäischen Kolonialmächte in Lateinamerika wendet und den USA das Recht zur Intervention vorbehält, jW) stets in der Nähe. Bis 1934 hatte die Regierung der Vereinigten Staaten das gesetzliche Recht, sich in Kubas innere Angelegenheiten einzumischen. Aber die amerikanische Vorherrschaft war vor allem spürbar durch die Unterstützung jeder kubanischen Regierung, die amerikanische Investitionen schützte. Zu meiner Zeit sprach niemand über Politik oder machte sich die Mühe herauszufinden, welche Bande gerade im Amt war und den Laden ausraubte. Ich kann mich nicht an irgendwelche Wahlen erinnern, obwohl die Regierungen, glaube ich, wechselten, sei es durch Palastrevolutionen oder einen Putsch. Damals hörte ich einmal auf einer Fahrt nach Havanna Schüsse, und mein Bekannter Salomon oder Straßenjungen rieten mir, mich in die Bar El Floridita zu setzen und gefrorene Daiquiris zu trinken, bis die Schießerei vorbei war; der Lärm kam von weit her aus Richtung des Hafens. Wir hielten das leichthin für einen Witz. Wen kümmerte es, welche Gauner an die Macht kamen, das Ergebnis wäre das Gleiche: Die Armen blieben arm, die Reichen reich, und ein anderes Pack Politiker würde sich bereichern. Nach dem Zweiten Weltkrieg, während der Batista-Diktatur, muss abgesehen von den üblichen Schrecken solcher Herrschaft – Verhaftungen, Folter, Hinrichtungen – die Korruption dank der treuen Freunde Batistas, der Mafia, außer Kontrolle geraten sein.
Im Museo Romantico, das früher der Palast eines Grafen gewesen sein soll, polterte eine Gruppe lärmender junger Leute die Treppen hinauf zu den Salons und Schlafzimmern. In dem Saal sagte eine weißgekleidete kleine Nonne, dass sie so etwas schon früher gesehen habe. »Wenn man in Spanien gelebt hat, kann einen in diesem Land nichts überraschen.« Sie war etwa dreißig Jahre alt und hatte ein strenges, scharfes Gesicht. Sie war mit den jungen Leuten von Cienfuegos nach Trinidad gekommen, um am nächsten Tag an einer Hochzeit in der Kathedrale teilzunehmen. Ihr Orden hat zwei Häuser, in Cienfuegos und in Havanna. Insgesamt sind sie acht spanische, drei mexikanische und drei kubanische Nonnen.
»Die Menschen müssen sehr tapfer sein, wenn sie zur Messe gehen wollen«, erklärte sie mir. »Wir gehen mit den jungen Menschen nicht hinaus auf die Straße aus Angst, sie zu gefährden. Es gibt viel Angst.«
»Angst? Sie meinen Angst vor dem Gefängnis, Angst um ihr Leben?«
»Nein, nein«, sagte sie ungeduldig. »Die Angst, ihren Job zu verlieren oder keinen guten zu bekommen, wenn gesehen wird, dass sie praktizierende Katholiken sind.« Die Messe wird hier in der Kathedrale und in einer anderen Kirche »dort unten« zweimal an Sonntagen gelesen, mehr nicht. Die spanische Nonne war empört. »Nein, Nonnen werden in keiner Weise schikaniert, aber wir dürfen nicht unsere seelsorgerische Arbeit auf den Straßen tun.« Was mich anbelangt, ich fand das gar nicht so schlecht: Ich will nicht, dass irgendeine Religion, säkular oder spirituell, mir auf der Straße Predigten hält. »Aber die Menschen sprechen noch mit uns.«
Ich wies sie darauf hin, dass sie mit einer ganzen Gruppe junger Menschen hier sei, um an einer kirchlichen Hochzeit teilzunehmen.
»Ja, sie sind sehr loyal«, antwortete sie.
Die strenge afrokubanische Museumswächterin starrte uns mit deutlichem Widerwillen an. Die Nonne sah das und bemerkte: »Sie will nicht, dass ich mit Ihnen spreche.« Doch niemand hielt sie davon ab, mit mir, einer offensichtlichen Ausländerin, zu reden.
Museen allerorten
Kuba ist voller Museen, Museen für alles, Vergangenheit und Gegenwart. Sie sind spärlich ausgestattet – keine großen Kunstschätze –, aber sie werden von jungen und alten Kubanern mit Interesse besucht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwo durch so viele Museen gerannt bin, und ich kann die Verantwortlichen verstehen. Dies ist Bewusstseinsbildung auf nationaler Ebene. Die Masse der Kubaner hatte keine Bildung und kein wirkliches Identitätsgefühl. Kubaner sein, hieß jemand anderes Untergebener sein, ein subalternes Volk. Ich kannte einige kubanische Sportler aus der Oberschicht; sie sprachen perfekt Amerikanisch, waren im Ausland erzogen worden und galten als Ehrenamerikaner oder -europäer, nicht dem Wort nach, auch nicht in Gedanken, sondern instinktiv: Sie wurden als zu überlegen empfunden, um Kubaner sein zu können. Jetzt wird den Kubanern durch die zahllosen Museen ihre Geschichte gezeigt, wie ihre herrschende Klasse lebte und wie das Volk lebte, die Revolten gegen die spanische »Herrschaft« und alles über die Revolution. Sie erfahren, dass sie schon, bevor die Kolonialherren kamen, die Insel bewohnten: Sie sind eine Nation und können sich mit Stolz als Kubaner fühlen.
Zwischen Trinidad und Sancti Spiritus sah das Land wie Afrika aus: knochiges buckliges Vieh wie das der Massai; Palmen und Kapokbäume, die hübschere kubanische Form des afrikanischen Baobabs; dschungelgrüne Hügel; braune Ebenen. Aber wo sollten wir schlafen? Wir waren von zwei Hotels abgewiesen worden, die ausgebucht waren. Die Kubaner reisen gerne. Wir machten uns erneut auf die Suche nach Zimmern.
Plötzlich ertönten lautes Hupen und Sirenen. Motorradpolizisten drängten den Verkehr an den Straßenrand. Zehn neue Busse rasten vorbei; die Kinder darin sangen, riefen und winkten. »Pioniere«, sagte Rafael. Es waren Grundschulkinder, jungen Pioniere mit dem hellblauen Halstuch. »Sie fahren zelten. Eine Woche mit ihren Lehrern, und sie machen dort mit dem Unterricht weiter.«
Für Schulstunden schien mir dieser Haufen viel zu überschwenglich.
»Fidel hatte als erster die Idee mit dem Campen«, fuhr Rafael fort. »Niemand in Kuba hatte das je getan, in einem Zelt wohnen und Lagerfeuer machen und kochen. Jetzt machen das alle. Es ist sehr beliebt.« Kubaner haben zweimal bezahlten Urlaub im Jahr, jeweils zwei Wochen, und abwechselnd ein volles Wochenende. Neben dem Camping gibt es viele neue Badeorte. Diese Anlagen sind einfach, rudimentär – man darf da nicht an die verführerischen Fotos in Reisebroschüren denken – und so preiswert, dass die meisten Kubaner es sich leisten können. Und es gibt Stadtparks mit Spielplätzen, Swimmingpools und Sportplätzen. Mir gefällt die Entscheidung der Regierung zugunsten des Vergnügens: Kubas Revolution ist nicht puritanisch. Das Verbot von Drogen, Glücksspiel und Prostitution merzte das Verbrechen als großes Geschäft aus, und das kann man wohl kaum als eine schlechte Idee bezeichnen. Aber geblieben sind das köstliche Bier und Rum und Zigaretten und Zigarren, da die Kubaner noch nichts von den Schrecken des Rauchens gehört haben. Aber ich denke, dass die Hauptursache für eine andere, offene, angenehme Lebensweise die Veränderung bei den Frauen ist. Die alte hispanische und katholische Tradition der Frau im Haus – die isoliert ist, die die Töchter bewacht und die Steifheit der Beziehung zwischen Männern und Frauen – ist wirklich weg. Frauen arbeiten selbständig, fühlen sich den Männern gleichgestellt und zeigen dieses neue Selbstvertrauen. Mädchen bekommen die gleiche Erziehung wie Jungen, und Überwachung gibt es nicht mehr. Es herrscht ein Gefühl, dass Männer und Frauen, Mädchen und Jungen auf eine zuvor unbekannte Weise zusammen eine gute Zeit haben.
Gesellschaft ohne Angst
Seit einem Vierteljahrhundert hat eine amerikanische Administration nach der anderen der Welt erklärt, wie der Kommunismus in Kuba funktioniert. Ich glaube kein Wort von dem, was irgendeine Regierung sagt. Beurteilt sie nach ihren Taten, nach den Ergebnissen, nach dem, was man selbst beobachten und von nichtoffiziellen Beobachtern erfahren kann. Abgesehen von Jimmy Carter haben alle amerikanischen Präsidenten Fidel Castro gehasst, als wäre er ein persönlicher Feind. Sie haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihn zu vernichten, und sind gescheitert. Da es politisch unmöglich ist zu akzeptieren, dass das Monstrum Castro vielleicht beliebt ist, sogar von seinem Volk geliebt wird, muss er der Unterdrücker von zehn Millionen eingeschüchterten Kubanern sein.
Was auch immer Kuba sein mag, es ist kein Polizeistaat, der mit Angst herrscht. Man spürt Angst sofort, egal ob die Polizei kommunistisch oder faschistisch ist, um die vereinfachten Begriffe zu verwenden. Angst zeigt sich in den Gesichtern und dem Verhalten der Menschen. Sie macht sie misstrauisch, besonders Fremden gegenüber. Und sie ist ansteckend; Angst infiziert die Besucher. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin nie so verängstigt gewesen wie in El Salvador, und ich zitterte vor Erleichterung, als ich sicher im Flugzeug saß, das Moskau verließ. Keine Regierung könnte die Fröhlichkeit und Freundlichkeit verordnen oder erzwingen, die ich in Kuba um mich herum erlebte. Ich habe hier nicht den Platz, um all die Menschen zu beschreiben, die ich an so vielen Orten traf, aber entscheidend ist: Keiner von ihnen hatte Angst, mit einer Fremden zu reden und meine Fragen zu beantworten, und sie sagten ohne Zögern ihre Meinung.
Martha Gellhorn: Das Gesicht des Friedens
Reportagen aus sechs Jahrzehnten Bd.2 (1960-1987)
Aus dem Englischen von Norbert Hoffmann. Mit einem Nachwort von Klaus Bittermann.
Edition Tiamat, Berlin, 500 S., 32 Euro
|
Veröffentlichung |
junge Welt, 30.03.2020