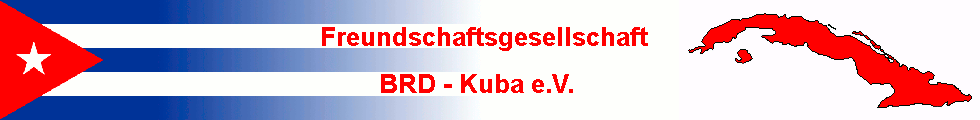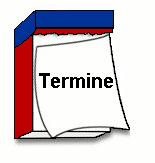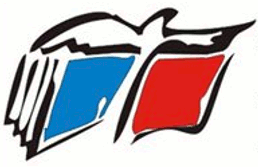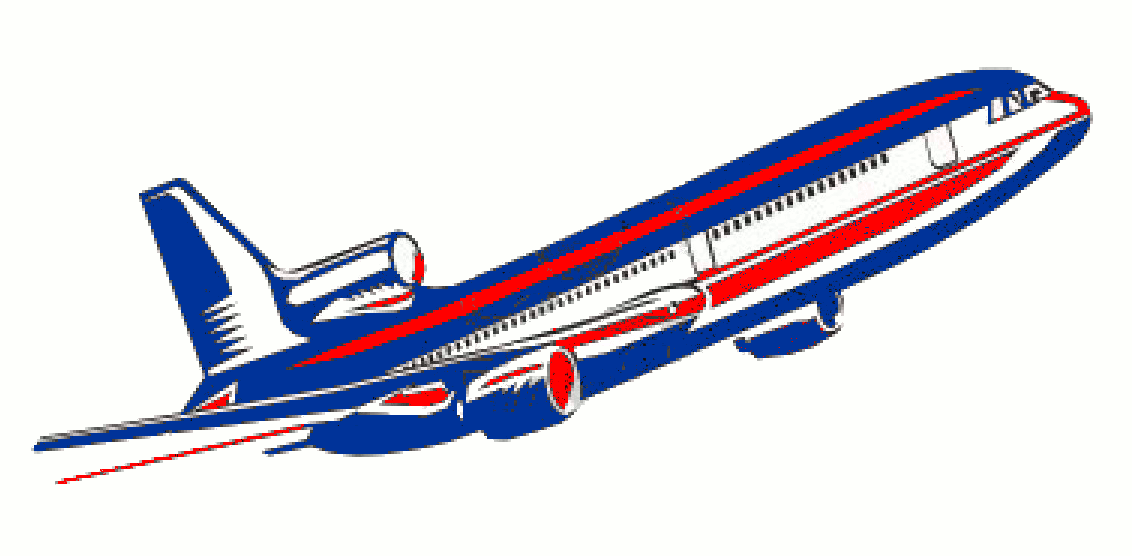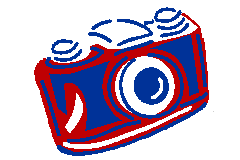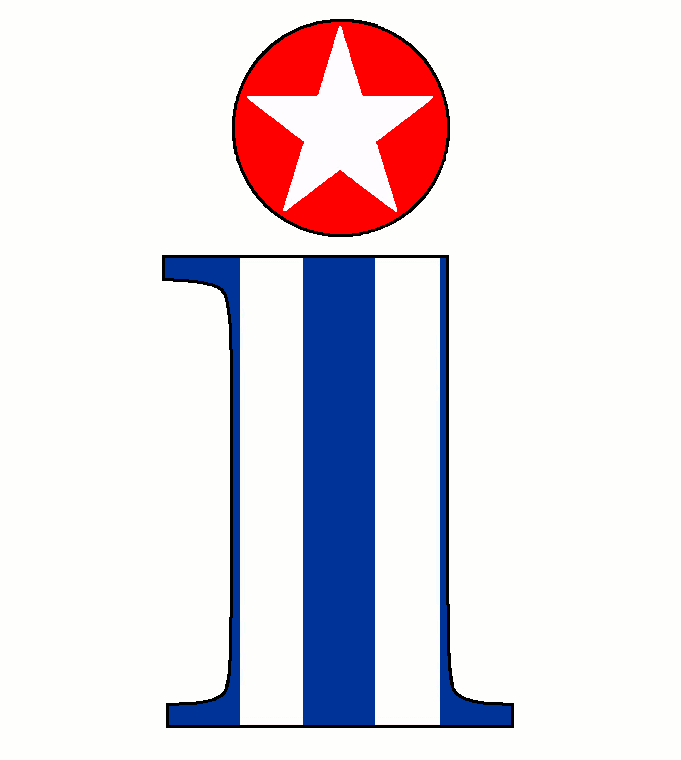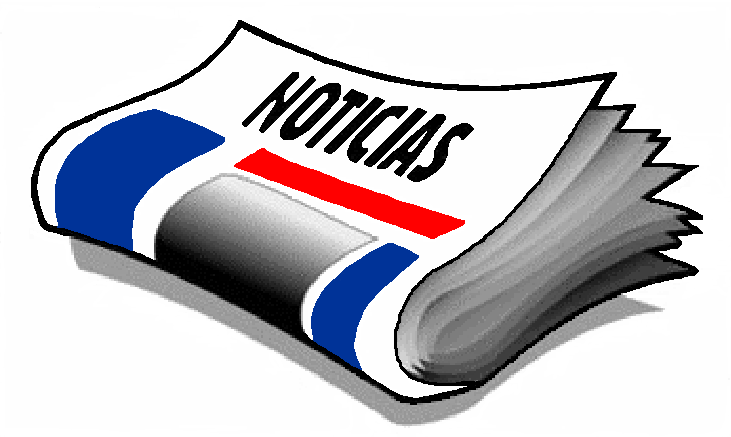
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
Das sprunggewaltige Solo
Düsterer Blick auf eine Kindheit im Sozialismus: Das Biopic »Yuli« über den kubanischen Ballettstar Carlos Acosta.
Wenn man einen Film über Kindheit und Jugend eines Ballettstars macht, sollte man sich auf die Kunstform des klassischen Balletts einlassen. Und wenn dieser Film im sozialistischen Kuba spielt, sollte man unbedingt auf dessen hervorragende Balletttradition eingehen. Unverzichtbar ist ein mitreißender junger Hauptdarsteller wie Jamie Bell im Film »Billy Elliot« (2000) über die unwahrscheinliche Ballettkarriere eines englischen Bergarbeiterkindes zu Zeiten der großen Streiks Mitte der 80er. In all diesen Punkten hat »Yuli« der spanischen Regisseurin Icíar Bolaín wenig zu bieten. Zwar verschränkt Bollaín (»El Olivo«, »Und dann der Regen«) die Jugend des kubanischen Startänzers Carlos Acosta mit dessen Gegenwart als Exballerino, der in Kuba eine moderne Tanztruppe gegründet hat. Aber nahe kommt man weder dem Ballett noch Acosta. Eher handelt es sich um einen Familienfilm, der in punktuell rührigen Szenen eine Vater-Sohn-Beziehung beleuchtet.
Der Beginn ist noch vielversprechend. Vater Pedro (großväterlich urig: Santiago Alfonso) zerrt seinen Sohn Carlos von der Straße. Er soll nicht Breakdance üben, sondern zum Ballett. Angeblich will Carlos das gar nicht – dennoch zeigt er sich bei der Aufnahmeprüfung an der staatlichen Eliteschule in Havanna auf Druck des Vaters hin sehr begabt. Dass Eltern bei solchen Aufnahmeprüfungen die ganze Zeit im Ballettsaal mit dabei sind, hat mit der Realität allerdings wenig zu tun. Solche Prüfungen laufen auch nicht als Einzelabfertigungen ab, sondern überwiegend in Gruppen. Schade, dass der Film hier schon so ungenau wird. Auf diesem Niveau bleibt er. Dass er nach der Autobiografie von Acosta entstand, macht es nicht besser.
Mit Klischees geht es weiter. Der Vater ist streng und prügelt, der Junge schwänzt trotzdem den Tanzunterricht, weshalb er in ein Internat au dem Land verbannt wird. Dort sieht er endlich einmal richtiges Ballett: Einer tanzt das sprunggewaltige Solo des Sklaven Ali aus »Le Corsaire«, mit dem rudolf Nurejew einst berühmt wurde. Jetzt will auch Carlos tanzen, dessen Großmutter noch Sklavin auf den kubanischen Zuckerrohrplantagen war – fortan strengt er sich an.
Carlos Acosta selbst sieht man im Film nur zwei Mal tanzen: in der Titelrolle von »Romeo und Julia« (Prokofjew) in seinen besten Londoner Zeiten und nach seiner Zeit als Ballerino. Da springt er zwar noch toll, hat seine Ausdruckskraft aber komplett eingebüßt. Ansonsten ist der Film mit schrecklich öden, pseudomodernen Tänzen der international auf Tournee gehenden, privat wirtschaftenden Truppe »Acosta Danza« aufgefüllt – nichts für Kenner.
Kuba ist in diesem Film vor allem von Armut geprägt. Immer wieder wird der wirtschaftliche Ruin des Landes beschworen. Fidel Castro erscheint nur, um türmende Landsleute auf ihren Booten Richtung Miami ziehen zu lassen. Dass Carlos seine exzellente Ausbildung dem kubanischen Staat verdankt, der auch die Klinikaufenthalte seiner Schwester in Havanna ermöglicht, findet keine Erwähnung. Aber nichtsdestotrotz sind Kubaner anscheinend lauter armseelige Fluchtwillige. Da wird ein Stromausfall inszeniert, als gingen die Lichter für immer aus. Eine Tanzeinlage erklärt, wer Schuld daran ist: Die Tänzer marschieren wie Bürozombies auf, der Songtext klagt Wall Street und Banker an. Die choreographische Misere von Acostas Truppe ist leider zu groß, als dass man das genießen könnte. Und wie zur Ehrenrettung des Imperialismus gewinnt der heranwachsende Acosta gleich darauf den begehrten »Prix de Lausanne«. In der Realität war das 1990 der Fall. Bald darauf nahm ihn das English National Ballet als Ersten Solisten unter Vertrag – ein Supertalent, das vom Fleck weg zum Star aufgebaut wurde. Carlos, von seinem Vater Yuli genannt, nach dem Sohn eines mexikanischen Kriegsgottes, wird der erste schwarze Romeo beim Royal Ballet in London.
Acosta verweigert im Film jedes Schauspiel. Mit stets düsterem Blick wird er, offenbar straff geliftet, zwischen die Rückblenden geschnitten: reglos, emotionslos. Nur wenn er tanzt, verbindet man den erwachsenen Mann mit dem Kind und dem Jüngling. Eine verpasste Gelegenheit, der Welt etwas vom kubanischen Ballett zu erzählen. Da ist es besser, man holt sich die DVD »Romeo and Juliet« mit dem jungen Carlos Acosta ins Puschenkino.
»Yuli«, Regie Icíar Bollaín, Kuba/Spanien/GB/BRD, 104 min.
Premiere in Anwesenheit von Carlos Acosta am Sonntag, 13 Uhr,
Cinema Paris in Berlin, regulärer Kinostart: 17. Januar
|
Veröffentlichung |
Gisela Sonnenburg
junge Welt, 05.01.2019