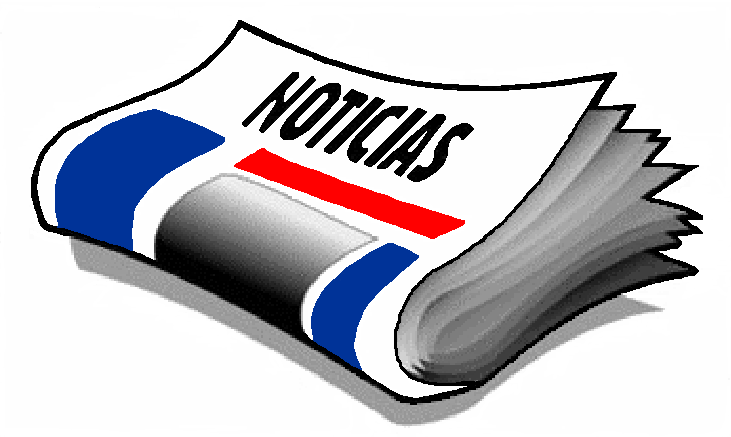
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
»Habe mich dem bewaffneten Kampf früh angeschlossen«
Gespräch mit Leonardo Tamayo. Über die kubanische Revolution, den Guerillakampf mit Ernesto »Che« Guevara und heutigen Internationalismus.
Sie haben an der Seite von Ernesto »Che« Guevara gekämpft – sowohl während der kubanischen Revolution in der Sierra Maestra als auch Jahre später in Bolivien. Warum haben sie sich den Guerilleros angeschlossen?
Ich hegte einen tiefen Groll, ja sogar Hass, gegen die Armee des kubanischen Diktators Fulgencio Batista. Ich habe wiederholt gesehen, wie seine Soldaten die Bauern misshandelt haben. Der Kommandant Joaquín Casillas (ein kubanischer Militär, der bereits 1948 für den Mord an einem Gewerkschaftssekretär verurteilt, aber rasch wieder freigelassen worden war, jW) hat beispielsweise die Bauern mit gefesselten Händen an dem Sattel seines Pferdes festgebunden und sie geschlagen. Einmal habe ich gesehen, wie er jemanden so verprügelt hat, dass sein ganzer Körper mit Blut bedeckt war. Das hat mich bereits in meiner Kindheit gegen die Streitkräfte aufgebracht, die die Bauern so misshandelt haben.
Hat ein Großteil der Landbevölkerung zu diesem Zeitpunkt so gedacht wie Sie? Wie bekannt war der Guerillakampf zu diesem Zeitpunkt überhaupt?
In der Bauernschaft wussten wir, dass Fidel in der Nähe des Strands Las Coloradas gelandet war, in der Gemeinde Niquero. Das hat sich unter den Bauern sehr schnell verbreitet. Als Fidel und die Armee der Diktatur die ersten Male aufeinandertrafen, war das in der gesamten Landbevölkerung ein großes Thema. Ich habe mich dem bewaffneten Kampf sehr früh angeschlossen. Alle Guerillakämpfe haben drei Phasen: In der ersten meidet die Bevölkerung das Heer der Rebellen, versteckt sich vor ihnen und gibt ihnen nichts zu essen. In der zweiten haben die Guerilleros bereits ein großes Gebiet befreit und der Großteil der Bauernschaft unterstützt sie. In der dritten steht die Bevölkerung vollständig hinter den Guerilleros. Ich habe mich bereits in der ersten Phase der Rebellenarmee in der Sierra Maestra angeschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt waren Sie gerade mal 15 Jahre alt. Was hat ihre Familie davon gehalten?
Ich bin Halbwaise, meine Mutter starb, als ich drei Jahre alt war. Wir sind fünf Geschwister – ich habe zwei ältere Schwestern und zwei jüngere. Als meine Mutter starb, musste mein Vater auch ihre Rolle einnehmen, er ist sehr gut mit uns umgegangen. Er hat sich einen Monat vor mir dem Rebellenheer in der Sierra Maestra angeschlossen. Weil mein Vater auch Tamayo hieß und wir im gleichen Heer gekämpft haben, haben sie mich dort später »Tamayito« genannt, ich war also der »kleine Tamayo«. Alle nennen mich bis heute so – auch meine Frau, weil sie sich über die Jahre daran gewöhnt hat. Von meinen Schwestern waren drei verheiratet und eine noch nicht. Sie habe ich in dem Haus von Freunden gelassen. Ich habe ihr gesagt, dass ich in die Sierra Maestra gehen würde und dass ich sie dort suchen käme, wenn ich nicht getötet würde. Ich habe überlebt und fand sie wieder, wo ich sie zurückgelassen hatte. Aber auch alle meine Schwager kämpften in der Sierra Maestra.
Wie sind Sie denn in das Rebellenheer aufgenommen worden?
Am 14. April 1957 schaffte ich es, Kontakt zu der Truppe von Che aufzubauen. Unser erstes Treffen war nicht besonders herzlich, er fragte mit argentinischem Akzent: »Was willst du hier?« Ich antwortete: »Das Gleiche wie Sie.« Das hat mir etwas Respekt eingebracht und er nahm mich auf. Nach vier, fünf Tagen brauchte Che jemanden, um eine Botschaft zu überbringen. Die übrigen Genossen aus der Stadt brauchten für diese Distanz durch die hügelige Landschaft zwei Tage, ich dagegen habe das als Bauernsohn noch am gleichen Tag erledigt. Als ich wieder an der Kommandantur ankam, rief er: »Hey, ich habe dich doch heute morgen mit einer Botschaft losgeschickt.« Ich bejahte und holte die Antwort von Fidel aus meiner Tasche. Als er sie las, begriff er, dass ich die Nachricht bereits überbracht hatte. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine militärischen Gepflogenheiten, um sich zurückziehen zu dürfen, deswegen habe ich einfach gefragt: »Darf ich gehen?« und er antwortete: »Ja, hau ab.« Zwei oder drei Tage später musste Che eine weitere Botschaft genauso dringend übermitteln und sagte: »Der kleine Indio vom letzten Mal soll kommen.« Ich lief mit der Botschaft los und, als es dunkel wurde, war ich schon wieder zurück. Statt wieder nachzufragen, hat er diesmal gleich die Antwort entgegengenommen. Ich habe dann weitere Botschaften überbracht und, nachdem ich diese Aufgabe ungefähr zwei Wochen lang übernommen hatte, sagte Che: »Bring deinen Rucksack hier herüber in die Kommandantur. Dann bist du gleich da, wenn ich wieder eine Nachricht verschicken muss.« Ich habe dann zehn Jahre und sechs Monate an der Seite Ches verbracht.
Zunächst haben Sie also Botschaften übermittelt. Welche Aufgaben hatten Sie später?
Ich wurde während unserer Offensive Ches Adjutant. Manche Genossen sagen, dass ich die Eroberung Kubas zwei oder dreimal gemacht habe: Wenn ein Genosse oder eine Gruppe verlorengegangen war, musste jemand loslaufen, um sie zu suchen, und dann zurückkehren, das habe ich gemacht. Ein Beispiel: Die allererste Vorhut war 500 oder 600 Meter weg, ich bin vorgelaufen, um sie einzuholen und zu sagen, dass sie warten müssten, weil einige zurückgeblieben sind. Dann bin ich wieder zurück zur Nachhut gelaufen, um die Verlorengegangenen zu suchen. Dann bin ich losgelaufen, um Che zu suchen und dann wieder zur Vorhut gelaufen. Das war eine der Aufgaben, die ich während der Invasion hatte.
Sie waren auch Mitglied in einer Elitetruppe namens »Suizidkommando«. Wie kam es dazu?
Wir waren in Las Villas, also bereits im Zentrum des Landes, angekommen. Che hatte mich mit einer Botschaft losgeschickt. Bei der Rückkehr war ein Genosse dabei, den sie »El Vaquerito«, den kleinen Cowboy, nannten – den Namen hatte ihm die Revolutionärin Celia Sánchez gegeben. Er wartete auf mich und sagte: »Ich habe einen Vorschlag, den ich Che unterbreiten möchte, und ich zähle dabei auf dich.« Ich fragte, worum es ging und er antwortete: »Ich möchte, dass wir eine Gruppe für ein Angriffskommando aufstellen.« Bei Che brachte Vaquerito dann unser Anliegen vor. Dieser sah uns an und sagte: »Dieser Name, ›Angriffskommando‹, gefällt mir nicht, der klingt zu sehr nach kapitalistischem, imperialistischen Heer. Warum nennen wir das nicht ›Suizidkommando‹ – ›Pelotón Suicida?‹« Diese Gruppe hatte die riskantesten Aufgaben, wenn etwa unsere Gegner in einem geschlossenen Haus waren, die Tür zu öffnen und eine Handgranate hineinzuwerfen. Ich bin auch zweimal angeschossen und einundzwanzigmal mit einer Granate verletzt worden. Ich habe meine Quote erfüllt. Ich bin mit 17 Jahren als Chef von Ches Eskorte an seiner Seite geblieben, und dann sein Adjutant geworden.
Sie waren auch in Bolivien dabei, wo Che Guevara 1967 ermordet wurde. Warum haben Sie als Kubaner überhaupt dort gekämpft?
Die Vereinigten Staaten hatten eine Studie veröffentlicht, wo es in Lateinamerika zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommen könnte. Bolivien hatten sie ausgeschlossen und festgehalten, dass es bereits eine Landreform gegeben habe, die geographischen Bedingungen nicht vorhanden seien, die Bevölkerung es nicht unterstützen würde und eine Revolution dort im Keim erstickt werden würde, weil Bolivien keinen Zugang zum Meer hatte. Angesichts dieser Situation entschied Che, dass, wenn sie sagen, die Bedingungen seien in Bolivien nicht gegeben, man dort erst recht den bewaffneten Kampf beginnen müsse.
Aber Kuba stand doch in dieser Zeit selbst vor zahlreichen Herausforderungen. Wieso dann nach Bolivien gehen?
Wir waren nur 17 Kubaner, das war keine Invasion oder so, nicht mal eine Truppe. Wir sollten nur die Bolivianer beraten, wir wollten sie unterstützen. Damit hatten wir nicht nur Freunde: Der Generalsekretär der dortigen Kommunistischen Partei war der erste, der uns verraten hat. Er war gegen den bewaffneten Kampf und versuchte, unserer Gruppe den Mut zu nehmen und uns zum Aufgeben zu bewegen. Aber warum hat Che in Bolivien gekämpft, warum – als Argentinier – in Kuba? Er ist zweimal durch Lateinamerika gefahren. Dabei hat er die Situation der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern kennengelernt. Als wir nach Bolivien gingen, lag die Lebenserwartung der Bauern bei 34 Jahren. Che wusste, dass 76,7 Prozent der Bevölkerung Analphabeten waren, und er kannte auch die hohe Mütter- und Kindersterblichkeitsrate. Deshalb hat Che gekämpft. Das ist Internationalismus.
Wie ist er dort mit seinen Mitstreitern umgegangen?
Ich möchte dazu eine Anekdote erzählen: Einmal hat er einem Genossen gesagt, er solle den Schichtplan für den Wachdienst machen. Später fragte er ihn nach der Liste, weil er wissen wollte, wann er Dienst habe. Als Che die Liste sah, stellte er fest, dass er nicht darauf stand, und sagte: »Wenn jeder 50 Minuten dran ist, gib jedem eine 50-minütige Schicht. Ich mache ab heute meinen Dienst wie jeder andere Soldat, unabhängig davon, ob ich hier für die Führung verantwortlich bin.«
Sie waren auch bei der Attacke dabei, bei der Che Guevara festgenommen und anschließend ermordet wurde. Wie ist es dazu gekommen?
Das letzte Mal, dass ich Che gesehen habe, war am 8. Oktober 1967 um zehn Uhr morgens. Er schickte mich mit einem weiteren Genossen los, einen Abschnitt eines Passes zu besetzen. Das haben wir gemacht. Das gegnerische Heer war auf dem Hügel. Sie schickten Soldaten auf beiden Seiten des Passes los und versuchten, uns zurückzudrängen und zu umzingeln. Aber weder Che noch wir sind in diese Falle getappt. Wir haben unsere Stellung gehalten. Doch Che hat versucht, unsere Verwundeten zum Arzt zu bringen. Als wir später dort ankamen, wo wir Che am Morgen zurückgelassen hatten, fanden wir die medizinischen Instrumente vor und den Mantel des Arztes. Als es dunkel wurde, kamen auch andere zurück. Sofort fragten wir sie nach Che. Sie fragten zurück, ob er nicht bei uns sei. Und sofort ging das Chaos ohne Führung los. Wir organisierten uns also neu und marschierten zu einem Treffpunkt, den Che festgelegt hatte, falls jemand verlorengehen sollte, etwa zwölf Tage Fußmarsch entfernt. Auf unserem Weg sind wir ganz nah an dem Ort vorbeigekommen, wo Che gefangengehalten wurde, nur 500 Meter entfernt. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir ihn natürlich gerettet.
Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?
Che hatte Benigno, einem kubanischen Genossen, ein Taschenradio überlassen, damit er Musik hören und darüber ein wenig vergessen konnte, dass er verwundet war. Das war unser einziges Kommunikationsmedium. Am Morgen des Tags nach der Attacke sagte ich während meines Wachdienstes zu Benigno: »Gib mir das Radio, damit ich Nachrichten hören kann.« Um acht Uhr morgens hörte ich ihm Radio, dass Che im Kampf verletzt worden sei, alle Dinge, die er im Rucksack hatte wurden beschrieben, auch seine Kleidung und sein Schutz für die Füße, weil er bereits seit einiger Zeit keine Stiefel mehr hatte. Um ein Uhr meldeten sie, dass er im Kampf schwerverletzt worden sei, und beschrieben wieder seine Besitztümer. Da haben sie schon begonnen, in Bolivien und weltweit auf die Ermordung vorzubereiten. Um acht Uhr abends sagten sie dann, dass der Che im Kampf gestorben sei, und beschrieben die gleichen Dinge. Sie hatten ihn aber an Händen und Füßen gefesselt, um ihn zu töten.
Sie sind einer von den drei Kubanern, die den Kampf in Bolivien überlebt haben. Wie sind Sie dort herausgekommen, nachdem Che ermordet und ihre Gruppe weitgehend zerschlagen worden war?
Das ist eine lange und schwierige Geschichte. Um Bolivien zu verlassen, mussten wir 2.900 Kilometer laufen, trafen 60 oder 70 Mal auf die bolivianischen Streitkräfte, hatten zwei Verwundete bei uns und wenig oder kein Essen. In den Anden mussten wir alle 50 oder 60 Meter anhalten, weil uns der Sauerstoff ausging. Letztlich sind wir in Chile angekommen, dort war das Volk auf der Straße. Das Verteidigungsministerium gab die Devise aus, dass wir durch kein Dorf fahren sollten, um die Menschenansammlungen zu meiden. Sie haben uns zu einer Basis der Streitkräfte gebracht, dort waren wir den ganzen Tag. Am Abend haben sie uns mit dem Flugzeug nach Antofagasta verlegt. Dort waren der Chef der Staatssicherheit und sein Stellvertreter, sie befragten uns. Schließlich haben sie uns nach Santiago gebracht, dort haben wir Salvador Allende getroffen. Damals noch Senator, hat er uns sehr geholfen, weil er unsere Auslieferung nach Bolivien verhindert hat, indem er Wachposten vor unseren Türen aufstellen ließ, weil er eine Entführung befürchtete.
In Bolivien hat auch Tamara Bunke gekämpft, die vielen Lesern dieser Zeitung als Internationalistin aus der DDR ein Begriff ist. Kannten Sie sie?
Klar, wie auch nicht. Für mich war Tamara, alias Tania, eine Heldin. Sie war eine sehr gute Schützin. In Bolivien war sie für die klandestine Organisation in der Stadt zuständig, für den ganzen Informationsfluss. Wieso sie dann letztlich mit uns im Dschungel gekämpft hat? Die Genossen Régis Debray und Ciro Bustos waren im März 1967 aus Kuba angekommen und hatten eine Botschaft von Fidel im Gepäck. In dieser Situation entschied Tania sich, mit ihnen zu gehen, um sie zu den anderen zu begleiten. Tania war ein Soldat – eine sehr feminine Frau, aber ein Soldat mit dem Mut eines Mannes im besten Sinne, und ihr wurde Respekt entgegengebracht. Sie ist am 31. August 1967 bei der Überquerung des Río Grande gestorben, nachdem der Bauer Honorato Rojas sie verraten hatte. In dem Hinterhalt wurde Tania verletzt und ließ sich vom Fluss davontreiben, aber die Soldaten sahen sie und ließen die Hunde auf sie los.
Was bedeutet Ches internationalistisches Beispiel für uns heute?
Che lebt und wird weiterleben im Herz aller fortschrittlichen Menschen der Welt, aller Revolutionäre. Menschen sterben, wenn die Völker sie vergessen. Che ist jemand, an den sich die ganze Welt erinnert. Ich war in Australien, dort haben sie seiner gedacht. Ich war dort auch an der Universität der Maori, der Ureinwohner, auch sie wussten, wer er war.
Aber es gibt mindestens zwei Formen des Gedenkens – einerseits sein Porträt auf Hemden oder Mützen herumzutragen, andererseits seine Ideen zu bewahren.
Man kann sein Bild auf einem Pullover tragen, ohne dass man ihn im Herzen trägt, seinen Internationalismus spürt. Wer das aber heute spürt, soll Technik und Wissenschaft studieren und den Völkern helfen. Man hilft den Menschen nicht dadurch, nur zu reden – die Rede mag noch so schön sein, aber das Gesprochene verliert sich im Wind. Wenn wir in der Lage sind, selbst den Schmerz zu spüren, den die Völker Lateinamerikas und der ganzen Welt erleiden müssen, dann sind wir Internationalisten.
Wovon hängt das Überleben der kubanischen Revolution heute ab?
Die kubanische Revolution hat überlebt und wird auch weiter überleben, denn sie hat die gesamte Welt, außer der Regierung der Vereinigten Staaten, an ihrer Seite. Wie viele Länder stimmen in der UN-Vollversammlung gegen die Blockade von Kuba! Die Kubanische Revolution gibt es wegen euch. Kämpft für uns, für diese kleine Insel in der Karibik, wie ihr es bereits jetzt tut! Kämpft auch um Venezuela, wie es mit diesem großartigen Menschen Hugo Chávez geworden ist, und das jetzt von Nicolás Maduro geleitet wird. Es hat das verdient.
Leonardo Tamayo … wurde 1941 in der kubanischen Provinz Sierra Maestra geboren, in der 1956 die Gruppe von Revolutionären um Fidel Castro landete. Mit 15 Jahren schloss er sich ihnen an. Er gehörte zum Kreis der engsten Vertrauten von Ernesto »Che« Guevara und begleitete ihn bis zu seinem Tod in Bolivien.
|
Veröffentlichung |
Interview: Lena Kreymann
junge Welt, 02.12.2017