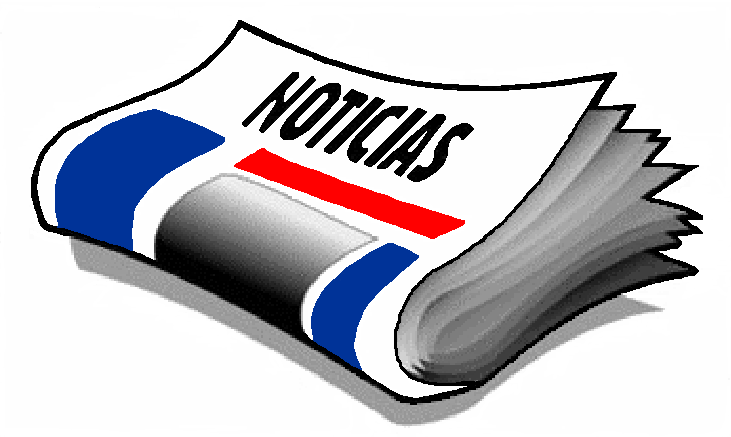
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
»Ich hätte mich ihm natürlich angeschlossen«
Gespräch mit Aleida Guevara March über die Geradlinigkeit ihres Vaters, die Vermarktung seines Porträts und die Beziehung von Kuba zu den Vereinigten Staaten.
Frau Guevara, Sie sind Ärztin – wie Ihr Vater. Sie sind Marxistin – wie Ihr Vater – gibt es etwas, worin Sie sich von ihm unterscheiden?
Natürlich. Ich bin eine Frau.
Anders gefragt: Würden Sie manche Entscheidungen anders treffen, als er es tat?
Ich reiche meinem Vater nicht bis an die Oberkante der Schuhsohle. Ich bin Kubanerin, ich versuche, meiner Weltanschauung und meinem Volk gerecht zu werden, aber mir fehlt viel zu seiner Ausstrahlungskraft. Da bleibt mir noch einiges zu tun.
Was kommt Ihnen zuerst in den Sinn, wenn Sie an ihn denken?
Seine Stärke, seine Geradlinigkeit als Mensch und seine Fähigkeit zu lieben. Ja, seine Fähigkeit zu lieben kommt mir zuerst in den Sinn. Ich war noch sehr jung, als er physisch aus meinem Leben verschwand. Aber er hatte in gewisser Hinsicht das große Glück, eine einzigartige Partnerin zu haben, die seinen Kindern1 viel von seiner großen Liebe zukommen ließ. Es war meine Mutter, die dazu beitrug, dass wir ihn trotz seiner Abwesenheit aus der Nähe kennenlernten. Ihr verdanke ich alles.
Als ich ungefähr sechzehn Jahre alt war, gab mir meine Mutter einige Manuskriptseiten zu lesen, ohne mir vorher zu sagen, worum es sich handelte. Als ich mich darin einlas, wurde mir bewusst, dass mein Vater dieses Buch während seiner ersten Reise durch Lateinamerika geschrieben hatte. Dieser junge Mensch schien mir viel näher als mein eigener Vater. Ich konnte mich besser mit ihm identifizieren, war ich doch fast in seinem Alter.
Schon vorher hatte ich, wie alle anderen kubanischen Kinder auch, Sachen gelesen, die mein Vater geschrieben hatte. Unser Motto lautete: »Pioniere für den Kommunismus – seien wir wie Che!« Ich wusste natürlich, dass die Rede dabei von meinem Vater war. Der Satz war jedem kubanischen Kind geläufig. Als ich sechzehn war, begann ich mich Dinge zu fragen wie »Hat er mich wirklich geliebt?« und ähnliches. Ich durchforstete meinen Kopf nach Erinnerungen und kam dann zu dem Schluss: »Ja, dieser Mann verstand es wirklich zu lieben.« Auf mich machte es den größten Eindruck, dass mein Vater stark genug war, seinen Weg zu gehen, aber zugleich zärtlich genug war, um sich bewusst zu sein, dass er seinen Kindern und seiner Frau fehlte. In einem Brief an meine Mutter gestand er ihr seine Schwächen ein und bat sie: »Aleida, bleib stark und hilf mir, meinen Weg zu gehen.« Das ist sehr schön, und ich sehe meinen Vater als den Menschen, der er ist: ein Mensch, in der Lage zu lieben.
Aber wie hat das zusammengepasst, sein Leben als Paradebeispiel eines Revolutionärs, aber zugleich seinen Kindern zugewandt?
Lediglich in der Hinsicht nicht, dass wir nicht alt genug waren, um seinen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen. Das ist alles.
Was bleibt im heutigen Kuba von Che Guevara?
In Kuba wird den Kindern beigebracht, sensibel für jegliches Unrecht zu sein, das irgendwo auf der Welt begangen wird. Ohne dieses Einfühlungsvermögen kann ein Mensch nicht komplett sein. Um eine neue Welt aufbauen zu können, brauchen wir Menschen mit dieser Fähigkeit. Wie wollen wir beispielsweise einem unserer Ärzte erklären, dass er sein Land verlassen und in Afrika sein Leben im Kampf gegen das Ebola-Virus riskieren soll, wenn er nicht über diese Vorbildung verfügt, diese Fähigkeit besitzt zu lieben, sich voll und ganz einzubringen. Es wäre unmöglich, dergleichen von ihm zu verlangen. Auf die Gefahr hin, dass ich als Romantikerin oder Trottel gelte, aber ich sehe es wie Che, dass ein Revolutionär ausgeprägte Gefühle der Liebe empfinden muss.
Sie haben gerade eine Rundreise durch die Schweiz beendet. Welcher Teil von Che Guevaras Vermächtnis kann heute in Europa wichtig sein?
Nun, manchmal ist es schwierig, in dieser Art von Gesellschaft, die guten Leute zu finden. Aber es gibt sie. In der Schweiz leistet beispielsweise seit vielen Jahren die Vereinigung Schweiz-Cuba unermüdlich Solidaritätsarbeit. In der Schweiz hat auch der Kampf gegen die US-Blockade einen seiner interessantesten Ausgangspunkte, denn hier ist die Organisation mediCuba entstanden, und dank dieser konnte die Blockade zu einem gewissen Zeitpunkt durchbrochen werden, indem man Grundstoffe für Medikamente nach Kuba schaffte, so dass das Land in der Lage war, seine eigenen Medikamente herzustellen.
Wenn ich heute in die Schweiz komme, dann bin ich natürlich im wesentlichen mit Menschen zusammen, die mein Land lieben, die Respekt vor der kubanischen Revolution empfinden und sie unterstützen. Die Veranstaltungen, die ich mache, sind aber für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir hatten eine bedeutende Zahl an Besuchern, egal, ob die Veranstaltungen werktags oder am Wochenende stattfanden, die Säle waren immer gut gefüllt. Mir ist dabei aufgefallen, dass sehr viele junge Menschen darunter waren. Mir scheint, dass einige von ihnen darüber nachdenken, wie man anders leben oder gesellschaftlich etwas verändern könnte.
Wie erklären Sie sich dieses ungebrochene Interesse an der Person Ihres Vaters?
Ich denke, dass Che zu einem internationalen Symbol geworden ist, und dass er dabei Grenzen überwunden hat. Er war ein sehr konsequenter Mensch, der stets sagte, was er dachte, und tat, was er sagte. Vielleicht macht ihn das in der heutigen Zeit zu etwas Besonderem, in einer Zeit, in der viele Menschen einen politischen Diskurs halten und anschließend etwas vollkommen Entgegengesetztes tun. Die Menschen sind diesen Betrug leid, diese Manipulation. Wenn sie dann von einem Menschen hören, der so konsequent war, dann erregt das Aufmerksamkeit und Neugierde.
Ihr Vater ist zu einem Vorbild geworden, aber zugleich zu einer Ikone. Was denken Sie, wenn Sie eine junge Europäerin mit einem T-Shirt mit dem Abbild Ihres Vaters sehen, oder einen jungen Kubaner mit seinem eintätowierten Konterfei?
Die Kommerzialisierung des Bildes missfällt mir. Wir versuchen, den unangemessenen Gebrauch seines Bildes einzuschränken. Dabei geht es uns nicht um das Geld, sondern um Respekt. Wo immer wir können, kämpfen wir dagegen an. Wir haben nein gesagt, als er auf einer Zigarettenschachtel abgebildet war, und auch für Bierwerbung wollten wir ihn nicht missbraucht sehen. Das wird ihm nicht gerecht.
Auf der anderen Seite hat einmal in Portugal ein Journalist einen Zwölfjährigen mit einem Che-Aufdruck auf dem T-Shirt auf einer Demonstration gefragt, was das Bild aussagen solle. Der Junge antwortete: »Genauso wie er will ich immer weiter kämpfen, bis zum Sieg!« Das ist doch eine wunderbare Antwort.
Was Tätowierungen angeht: Ich bin Ärztin, und antworte Ihnen als solche. Die Haut ist das größte menschliche Organ. Deshalb mag ich keine Tätowierungen, ich mag keine großflächigen Verletzungen der Haut. Ich ziehe es vor, dass ein junger Mensch ihn in seinem Herzen trägt, in seinem Denken, in seinem Handeln.
Ich habe einmal etwas von einer Argentinierin gelernt, der die sterblichen Überreste ihrer Tochter übergeben wurden, nachdem sie jahrelang »verschwunden« war. Auf ihren Grabstein ließ sie etwas Wunderbares einmeißeln: »Weine nicht um mich, wenn ich sterbe – setze mein Werk fort, und ich werde in dir weiterleben.« Diesen Umgang wünschen wir uns mit Che. Nicht, ihn in eine Tätowierung zu verwandeln, in ein kommerzielles Abbild, sondern, ihn in die Tat umzusetzen. Ihn kennenzulernen, um ihn anzuwenden, um ihn diskutieren zu können.
Welchen Stellenwert haben seine Gedanken denn heute?
Einmal besuchte ich in Algerien in verschiedenen Krankenhäusern kubanische Ärzte. Als ich in das zweite Krankenhaus kam, kam eine Gruppe junger Algerier angelaufen, außer Atem, und sagte mir: »Wir hatten Sie im ersten Krankenhaus verpasst, wir wollten sie aber unbedingt sehen. Sie sind doch die Tochter von Che, und der ist einer von uns.« Es stellte sich heraus, dass Algerien gegen Ägypten im Fußball gewonnen hatte, und die Gruppe war davon überzeugt, dass dies nur möglich gewesen war, weil Che mit ihnen war. Was sollte ich dazu sagen? – Wenn ihr es so fühlt und seht: Halleluja! In jedem Fall war zu spüren, dass es ihr Che ist.
In Südafrika wurden mein Bruder Camilo und ich von einem ganzen Dorf im Gleichschritt empfangen. Für Camilo war es der peinlichste Moment des Jahrhunderts. Egal, wo Du bist, überall begegnet Dir diese Kraft von Menschen, die davon überzeugt sind, dass Che bei ihnen ist, dass er auch ihnen gehört. Der Schriftsteller José Martí hat einmal gesagt, dass ein Mensch die Tugenden in einem anderen Menschen erkennt, weil er sie selbst in sich trägt.
Sie bereisen die Welt, halten Vorträge, diskutieren mit vielen Menschen. Fragen Sie sich manchmal, was Sie damit bewirken?
Ich will niemanden überzeugen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du glaubst mir, oder du glaubst mir nicht. Wenn du mir nicht glaubst, hast du die Möglichkeit, dir selbst Informationen zu suchen, was dich auf eine gewisse Weise auch aufweckt. Wenn ich die Leute auf diese Weise bewegen kann, habe ich mein Ziel erreicht. Nützt es letztlich meinem Volk, hat es sich gelohnt. Es lohnt sich eigentlich immer.
Wie bewerten Sie die aktuellen Beziehungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten?
Warum blockieren uns die USA heutzutage immer noch? Weil wir ein schlechtes Beispiel darstellen. Wenn alle Länder der sogenannten Dritten Welt das täten, was Kuba getan hat, sich ihrer Ressourcen bemächtigen, sie nicht mehr herschenken, sondern sie zu fairen Konditionen verkaufen, was müssten dann die USA alles aufbringen, um ihren Lebensstandard zu halten? Denken wir nur an den Verbrauch an Erdölprodukten – es wäre praktisch unmöglich. Insofern stellt das Beispiel Kubas ihr weiteres Überleben in der derzeitigen Form in Frage.
Wir Kubaner müssen auf alles vorbereitet sein. Die US-Armee mag stärker sein als unsere, ohne Zweifel, sie haben die mächtigeren Waffen. Aber hinter Kuba steht ein ganzes Volk. Ich sage immer: Ich bin Ärztin, dafür ausgebildet, Leben zu retten, aber ich weiß auch mit der Waffe umzugehen und schieße ganz ordentlich. Ich werde jeden Quadratzentimeter meines Heimatlandes verteidigen, um jeden Preis. Die übergroße Mehrheit unseres Volkes wird immer auf diese Weise reagieren, in diesem Sinne sind wir vorbereitet, und deshalb wird es jeder Angriffsplan gegen die kubanische Revolution schwer haben.
Wir sind uns über etwas sehr Wichtiges klargeworden: Die einzige Überlebensmöglichkeit für Kuba besteht in seiner Revolution, in ihrer Weiterentwicklung, ihrer Verbesserung, aber letzten Endes in der Revolution selbst. Ohne unser Gesellschaftsprojekt würden wir auf der Stelle eingehen.
Wir bewahren uns unsere sozialistische Gesellschaft, um leben und jeden Tag etwas besser leben zu können. Nun, da wir zugleich mit vielen anderen Völkern solidarisch sind, werden wir nie ein explosives Wachstum erleben, werden wir nicht von heute auf morgen alle in Seligkeit leben. Wenn wir vorankommmen, müssen wir darauf achten, dass auch die anderen vorankommen, im Bereich der Bildung oder der Gesundheit. Ich genieße es wirklich, in Kuba zu leben.
In diesen Tagen jährt sich der 50. Jahrestag der Ermordung Ihres Vaters. Was bedeutet das für Sie?
Das ganze Jahr war aufgrund des Todestages sehr bewegt. Unzählige Solidaritätsorganisationen auf der ganzen Welt haben Veranstaltungen organisiert, und so hat mich das kubanische Institut für Völkerfreundschaft viel auf Reisen geschickt. So gesehen war es ein hartes Jahr, aber auch enorm befriedigend zu sehen, dass Che die Menschen immer noch in Bewegung setzt.
In den nächsten Monaten werde ich auf Einladung des Präsidenten Evo Morales zu einer zentralen Veranstaltung anlässlich des 50. Jahrestag der Ermordung meines Vaters nach Bolivien reisen. Anschließend bin ich zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Russland eingeladen. Es wird bestimmt eine Freude, den jungen Menschen zuzuhören, mit all ihren Problemen und Träumen, ihren Plänen. Danach fliege ich nach London, von dort weiter auf das Europatreffen der Kuba-Solidarität nach Bulgarien, und danach werde ich wohl nach El Salvador fliegen, um später wieder nach Italien zu kommen.
Den 8. Oktober werden sie mit ihren Geschwistern am Ort der Ermordung Ihres Vaters in Bolivien verbringen. Was erwartet Sie dort?
Zunächst muss ich die Sache mit dem Datum richtigstellen. Mein Vater wurde am 9. Oktober ermordet. Unser Fidel mit seiner wunderbaren Art, die ihm immer zu eigen war, legte aber fest, dass der 8. Oktober als Jahrestag begangen werden sollte, den Tag seiner letzten Schlacht. Deshalb erinnern wir uns an diesem Tag an ihn, auch wenn er tatsächlich am 9. Oktober ermordet worden ist. Wir werden an diesem Tag alle vier in Bolivien sein, und es wird ein schwerer Moment werden, vor allem für meine Schwester Celia, die noch nie dort war, wie es auch für mich beim ersten Mal belastend war. Es sind ja auch die sterblichen Überreste von seinen Genossen dort gefunden worden. Einerseits sagt man sich: Wer gestorben ist, ist tot. Dann denkst du an die Genossen, die auch Familien und ihre Kinder, in manchen Fällen noch Babys, zurückgelassen haben, und stellst dir vor, dass es für sie noch viel härter sein muss. Der eine oder andere mag denken: Mein Vater kam hierhin, ist für das Volk von Bolivien gestorben und bis heute gibt es keine Erinnerung an ihn. Möglicherweise ist das so. Der Schmerz ist immer da, aber wenn man älter wird, stellt man sich auf andere Weise vor, was damals geschah, und das tut weh. Zugleich empfindet man aber auch unermesslichen Stolz. Die Gefallenen haben damals über diese Dinge nicht nachgedacht. Sie waren außergewöhnliche Menschen in dem Sinne, dass sie das Beste, ihr Leben, für eine Sache gegeben haben, die ihnen gerecht erschien, und um einem anderen Volk zu helfen. In diesem Sinne können wir eigentlich nur Bewunderung für sie empfinden, sicherlich werden wir genau das verspüren.
Welche Rolle spielt der Internationalismus im Denken Ihres Vaters?
Mein Vater hat sich einmal so dazu geäußert, dass es sein größter Traum wäre, dass eines Tages ein Kongolese, ohne mit der Wimper zu zucken, für die Unabhängigkeit eines asiatischen Landes fallen wird, oder ein Lateinamerikaner, ohne zu zögern, sein Leben für ein europäisches Land gibt, weil es für alle nur noch darum geht, die gemeinsame Sache zu verteidigen.
Wenn Ihr Vater noch lebte, was wäre anders in Lateinamerika?
Wenn mein Vater noch leben würde, wäre Mauricio Macri nicht an der Macht. Wir hätten ein anderes Argentinien, denn er hatte vor, von Bolivien nach Argentinien weiterzuziehen. Wenn mein Vater heute noch lebte, würde das bedeuten, dass er gesiegt hätte – schließlich stammt von ihm der Ausspruch, dass ein Revolutionär entweder siegt oder stirbt. Würde er heute noch leben, so müsste das also bedeuten, dass er in all den Jahren den gesamten südlichen Teil unseres Kontinents revolutioniert hätte. Und würde er einmal mit einer Revolution nicht erfolgreich sein, so würde er sich sofort daranmachen, die nächste vorzubereiten. Er könnte nicht anders. Auch für mich wäre die Welt anders, denn ich hätte mich ihm natürlich angeschlossen, um ihn auf diesem Weg zu unterstützen.
1) Neben Aleida Guevara March, geb. 1960, sind das Hilda Guevara Gadea, geb. 1956, Camilo Guevara March, geb.1962, Celia Guevara March, geb. 1963, und Ernesto Guevara March, geb. 1965
Aleida Guevara March ist die Tochter von Ernesto »Che« Guevara und Aleida March. Sie ist Ärztin am William-Soler-Kinderkrankenhaus in Havanna, unterrichtet an der Escuela Latinoamericana de Medicina und an einer Grundschule. Sie hat als Kinderärztin in Angola, Ecuador und Nicaragua gearbeitet und beteiligt sich als Mitglied der KP Kubas oft an Veranstaltungen im Ausland.
|
Veröffentlichung |
Interview: Tobias Kriele
junge Welt, 07.10.2017