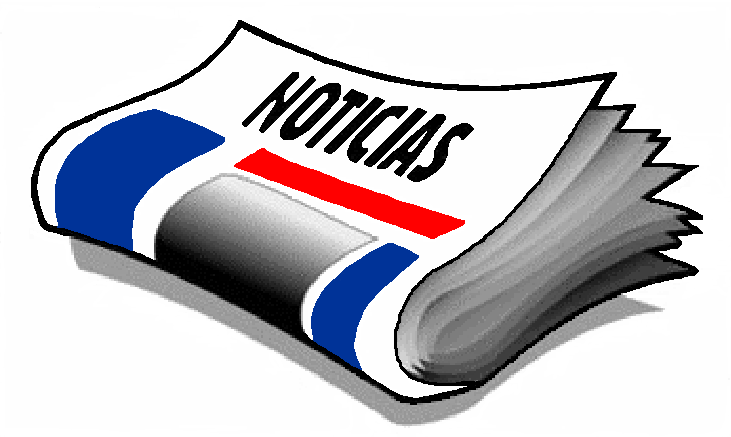
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
»Wir sollten uns die primäre Versorgung abgucken«
Gespräch. Mit Franco Cavalli. Über die Auswirkungen der US-Blockade auf das kubanische Gesundheitssystem und Krebs als »Krankheit der Armen«.
Im Jahr 1992 gründeten engagierte Schweizer Ärzte den Verein Medicuba Suisse. Einige Jahre später entstand Medicuba Europa, dessen Präsident Sie sind. Welche Ziele verfolgen die Vereine?
Als Kubas Gesundheitssystem nach dem Untergang der Sowjetunion und der sozialistischen Länder Osteuropas in Gefahr geriet, haben wir Medicuba Suisse gegründet. Wie in Betrieben und auf dem Land standen auch in Kubas Krankenhäusern viele Maschinen still. Es gab kein Material und keine Ersatzteile für medizinische Geräte, es fehlte an Medikamenten und Hilfsmitteln. In dieser Situation wollten wir Kuba bei der medizinischen Versorgung seiner Bevölkerung helfen. Wenig später gründeten wir deshalb auch Medicuba Europa. Diese Organisation besteht aus 13 Vereinen, von denen die meisten, so etwa in Luxemburg, Schweden, Irland, Frankreich, Italien und der Schweiz, auf nationaler Ebene agieren. Daneben gibt es örtliche Gruppen wie die Humanitäre Cubahilfe in Bochum, die in der Bundesrepublik aber auch nationale Bedeutung hat. In den vergangenen 20 Jahren konnte Medicuba Europa Projekte mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro fördern. Wir verfolgen zwei Hauptziele. Auf der einen Seite wollen wir dem kubanischen Gesundheitssystem bei der Arbeit im eigenen Land helfen. Auf der anderen Seite unterstützen wir Kuba bei seiner internationalen Tätigkeit. Das medizinische System Kubas hat eine große Bedeutung für die gesamte sogenannte dritte Welt. Wenn man irgendwo im Urwald auf einen Arzt trifft, ist das mit Sicherheit ein Kubaner oder jemand, der in dem Inselstaat ausgebildet worden ist.
Kubas Gesundheitssystem gilt doch als gut. Warum sind Ihre Projekte trotzdem notwendig?
Natürlich ist das ein sehr gutes Gesundheitssystem. Die Weltgesundheitsorganisation hat es zum Vorbild erklärt und empfohlen, dass alle Länder des Südens ihr Gesundheitssystem so strukturieren. Doch durch die Wirtschaftsblockade der USA und das Verschwinden der sozialistischen Länder im Osten Europas kam Kuba in den 1990er Jahren in Schwierigkeiten. Fehlt in der Gesundheitsstruktur zum Beispiel nur ein Instrument oder funktioniert die Desinfektionsmaschine nicht, dann hat das weitere Folgen, und letztlich kann die ganze Kette blockiert werden. Wir haben gesehen, dass Kuba ein vorbildliches Gesundheitssystem aufgebaut hat, und viele Mediziner wollten nicht, dass dieses Modell kaputtgeht. Dazu wäre es aber beinahe gekommen, weil das Land nirgendwo die notwendigen Instrumente kaufen konnte. Da die USA ihre Blockade auch auf Drittländer ausdehnen, haben viele Firmen Angst, etwas an Havanna zu liefern. Sie fürchten, mit Bußgeldern belegt zu werden, und laufen Gefahr, ihre Produkte nicht mehr auf dem US-Markt vertreiben zu dürfen. Wenn Kuba trotzdem irgendwo die notwendigen Geräte und Medikamente kaufen kann, wird oft erheblich mehr als der übliche Marktpreis dafür verlangt. Obwohl die ärzte sehr gut sind, können auch sie den Menschen in vielen Fällen ohne Technologie nicht helfen. Die Blockade droht also ein vorbildliches System zu zerstören. Deshalb sind unsere Projekte notwendig. Die Tatsache, dass Kuba heute eine so leistungsfähige pharma- und biotechnologische Forschung und Produktion hat, verdankt das Land auch der Hilfe der DDR. Vor der Revolution war Kuba nämlich ein genauso unterentwickeltes Land wie alle anderen in der Region.
Wie hat sich das Engagement von Medicuba in den vergangenen 20 Jahren entwickelt?
Vieles ist gleich geblieben, wie unsere Unterstützung für die Lateinamerikanische Medizinschule ELAM, die eine phantastische Institution ist. Wir schicken Computer und Fachbücher oder übernehmen Stipendien. Geblieben ist auch unsere finanzielle Unterstützung für internationale Hilfsprojekte, die Havanna zum Beispiel in Haiti leistet. Ansonsten hat sich unsere Tätigkeit aber weiterentwickelt. Wir hatten mit sehr vielen kleineren Projekten begonnen. So haben wir punktuell zu helfen versucht, wenn es in einer Klinik kein Gastroskop, Kolonoskop oder Bronchoskop mehr gab oder die Desinfektionsmaschine nicht mehr funktionierte. Anfangs haben wir auch relativ viele Häuser gebaut, in denen Familienärzte wohnen und ihre Praxis haben. Später haben wir mit dem ersten größeren Projekt begonnen, das etwa bis vor etwa zwei Jahren lief. Wir organisierten die Lieferung von chemischen Rohstoffen, damit die kubanische Pharmaindustrie essentielle Medikamente selbst produzieren konnte. Das ist mittlerweile nicht mehr nötig, da China viele Generika (wirkstoffgleiche Präparate, jW) liefert.
In der letzten Zeit konzentrieren wir uns auf die Spitzenmedizin. Neben der Unterstützung des Nationalen Krebsinstituts und der biotechnologischen Forschungs- und Produktionsstätten helfen wir bei der Ausbildung von Spezialärzten. Kuba hat – das erkennen inzwischen sogar die USA an – einen sehr hohen Standard in der biotechnologischen Forschung. Das Land produziert wertvolle Impfstoffe und viele Medikamente, die es auch bei uns gibt, die hier aber viel teurer sind. In Kuba können Entwicklungsländer solche Medikamente deutlich günstiger bekommen. Doch um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, müssen Fachleute ausgebildet werden, und es werden Apparate benötigt, die wegen der Blockade oder fehlender Mittel nicht gekauft werden können. Wir arbeiten vor allem mit dem Zentrum für molekulare Immunologie, dem CIM in Havanna, zusammen, das ist eine wichtige Säule von Kubas Technologiepool. Das Institut produziert essentielle Medikamente für die Krebsbehandlung.
Es gibt auch neue Probleme. Seitdem medizinisches Personal frei reisen kann, werden einige der hervorragenden Fachärzte gezielt vom Ausland abgeworben. Dubai hat zum Beispiel ein ganzes Team von Ärzten eingekauft, das in Kuba auf Herztransplantationen spezialisiert war. Nun gehen sie für fünf Jahre nach Dubai, bekommen dort eine halbe Million Dollar pro Jahr und müssen für den Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten. Das ist neben den US-Aktivitäten zur gezielten Abwerbung kubanischer Ärzte ein Problem.
Welche besonderen Erfolge gab es in den letzten Jahren?
Neben dem Rohstoffprogramm, das jetzt nicht mehr benötigt wird, gehört dazu die Veränderung im Umgang mit Homosexuellen und HIV. Die Schweiz hat wohl eines der besten Vorsorgeprogramme zur Vermeidung von HIV. In Kenntnis dessen haben wir gemeinsam mit den kubanischen Kollegen spezielle Vorsorgeprogramme für ihr Land entwickelt. Deshalb werden HIV-Patienten heute in Lateinamerika nirgendwo so gut behandelt wie in Kuba. Ein weiteres Beispiel ist das Medikament Dactinomycin, das für die Behandlung von Krebs bei Kindern unverzichtbar ist. Dieses Medikament wurde früher von mehreren Firmen produziert, zuletzt aber nur noch von einem US-amerikanischen Unternehmen. Das führte dazu, dass der Preis um rund dreitausend Prozent anstieg und Dactinomycin wegen der US-Blockade nicht mehr nach Kuba geliefert wurde. Unsere italienische Sektion hat mit einer Kampagne dafür gesorgt, dass dieses Medikament trotzdem für die Therapie krebskranker Kinder in Kuba zur Verfügung stand. Mittlerweile wird Dactinomycin auch in China produziert, und das Problem ist gelöst.
Welche Projekte hat sich Ihre Organisation für die nächsten Jahre vorgenommen?
Das bedeutendste ist ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt, das wir gemeinsam mit dem Institut für Tropenkrankheiten Pedro Kouri in Havanna, abgekürzt IPK, entwickelt haben und das vom kubanischen Gesundheitsministerium als prioritär eingestuft wird. Mit Hilfe dieses Projektes sollen diagnostische Möglichkeiten eingeführt werden, die es im Land momentan noch nicht gibt. Wir wollen Kuba – angesichts der Zunahme von Infektionskrankheiten in Lateinamerika – dabei unterstützen, der Bevölkerung und Besuchern landesweit eine hochmoderne Technologie zur Verfügung stellen zu können. Ziel ist die Einrichtung einer gentechnologisch basierten mikrobiologischen Diagnostik, die der konventionellen Methode an Schnelligkeit, Genauigkeit und Sicherheit deutlich überlegen ist. Besonders hat man dabei Krankheiten wie Dengue, Cholera, Tuberkulose, Ebola, Zika, AIDS, Grippeepidemien und die Chikungunyainfektion im Auge. Kuba verfügt bereits über ein Netz von 16 Laboratorien für Mikrobiologie auf Provinzebene. Diese Laboratorien decken zwar einen weiten Bereich der Diagnostik mittels konventioneller Technologien ab, aber es steht ihnen kein Labor für molekulare Diagnostik zur Verfügung. Nun sollen neben dem IPK in Havanna noch zwei weitere Laboratorien nationaler Referenz in Santiago de Cuba und in Villa Clara eingerichtet und das IPK sowie die provinziellen Labors aufgerüstet werden.
Das klingt ambitioniert. Was kostet das, und wie wird es finanziert?
Wir rechnen mit Kosten von rund 2,5 Millionen Euro für das gesamte Projekt. In diesem Jahr sollen 350.000 Euro für die Einrichtung einer parasitologischen Abteilung im IPK und die Aufrüstung der Provinzlaboratorien zur Verfügung gestellt werden. Rund zwei Drittel dieser Summe haben wir schon beisammen. Die Mitglieder der einzelnen Sektionen sammeln Spenden bei Aktionen, Veranstaltungen und Festen. Jeder noch so kleine Betrag hilft uns und Kuba.
Wie kommt ein Krebsarzt zum Engagement für Lateinamerika, für Kuba und andere Länder des Globalen Südens?
Meine heutige Frau, eine Onkologieschwester, ging 1985 nach Nicaragua, um die sandinistische Revolution zu unterstützen, und gründete dort das erste kleine Ambulatorium. Als ich sie besuchte, traf ich auf kubanische Ärzte, mein erster Kontakt mit dem Gesundheitssystem der Karibikinsel. In Nicaragua habe ich wahrgenommen, wie bedeutsam die Krebserkrankungen in der »dritten Welt« sind. Insbesondere Frauen sind betroffen und leiden – wie in der Mehrzahl der Entwicklungsländer – vor allem an Gebärmutterhalskrebs. Diese dort am häufigsten vorkommende Tumorkrankheit kann man bei uns in den meisten Fällen relativ leicht heilen. Aber dort starb ein Großteil der erkrankten Frauen daran. Ich wollte das nicht hinnehmen und gründete einen Verein für medizinische Hilfe in Zentralamerika. Wir organisierten Projekte in Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Chiapas in Mexiko. Von 2006 bis 2009 war ich Präsident der UICC, der Union Internacional Contra el Cancer, des Internationalen Verbands gegen Krebs, und bin viel gereist. Ich war der erste, der Alarm schlug und warnte, dass die Zahl der Tumorleiden in den Entwicklungsländern zu explodieren drohe und Krebs bald weltweit zur Krankheit Nr. 1 werden würde. Mittlerweile ist er leider in puncto Sterblichkeit tatsächlich zur Todesursache Nr. 1 in der Welt geworden.
Sie bezeichnen Krebs auch als »soziale Krankheit« und als »Krankheit der Armen«.
In der Schweiz können wir anhand der Tumorregister statistisch nachweisen, dass arme Leute ein höheres Krebsrisiko haben als die Reichen. Die können dank besserer Information nicht nur Risiken wie Rauchen, Alkohol, ungesunde Ernährung und Übergewicht besser vermeiden, sondern zudem Geld für ihre Fitness ausgeben. Arbeitsbedingungen machen ebenfalls krank. Arbeiter müssen oft mit schädlichen Stoffen umgehen, sind Staub ausgesetzt und werden unter Druck gesetzt. Vielen ist nicht bewusst, dass Krankheiten auch sozial bedingt sind. Im globalen Süden kommen zu den armutsbedingten Krebsarten wie Speiseröhren-, Gebärmutterhals-, Leber- oder Magenkrebs immer mehr Krebsarten hinzu, die bisher in den industrialisierten Ländern verbreiteter waren. Dazu gehören Lungen-, Brust-, Prostata- und Darmkrebs. Einer der Gründe dafür liegt in den noch schlechteren Umweltbedingungen in diesen Ländern. Aber auch der Wechsel von einer bis dahin eher natürlichen Ernährung zu Fastfood trägt dazu bei. Dies ist vermutlich die Ursache, warum in diesen Ländern jetzt Darmtumore, die früher sehr selten waren, häufiger auftreten. Heute finden wir dort die Gesamtheit aller armuts- und reichtumsbedingten Tumoren – aber kaum eine Möglichkeit, Frühdiagnosen zu machen.
Als größtes Krebsgeschwür bezeichnen Sie die Macht der Banken und der Pharmalobby. Was meinen Sie damit?
Die Pharmaindustrie erzielt Gewinnmargen wie kein anderer Wirtschaftszweig. Sie kalkulieren mit 20 bis 25 Prozent. Eine Krebsbehandlung kostet heute 40mal mehr als vor 25 Jahren, aber unsere Resultate sind nicht 40mal besser geworden. Neue Krebsmedikamente kosten im Schnitt zwischen 10.000 und 13.000 Euro pro Patient und Monat. Diese Preise kann auf mittlere Sicht nicht einmal das Gesundheitssystem der reichen Schweiz verkraften. Die Pharmaindustrie kalkuliert schon ein, dass die Zweiklassenmedizin zum Standard wird. Ein Grundübel besteht darin, dass der Richtpreis für Medikamente in den USA bestimmt wird, wo rund 60 Prozent der Krebsmittel verkauft werden. Und die Pharmaindustrie setzt kleinere Länder unter Druck, indem sie keine Medikamente liefert, wenn nicht der verlangte und in den USA übliche Preis gezahlt wird. In den USA haben die von der Pharmaindustrie unterstützten republikanischen Präsidenten aber alle Gesetze außer Kraft gesetzt, die dem Staat eine Möglichkeit der Preiskontrolle von Medikamenten gaben. Am Tag nach der Wahl Donald Trumps sind die Aktien der Pharmaindustrie als erste im Kurs gestiegen. In der Schweiz stellten früher einmal die Banken die stärkste Lobby, heute ist das die Pharmaindustrie.
Sind ihr Patienten und Mediziner in der kapitalistischen Welt denn wehrlos ausgeliefert?
Im Moment ist die einzige Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, die Öffentlichkeit über die Methoden der Pharmalobby zu informieren. Nur wenn der Druck auf die Politik so groß wird, dass er nicht mehr ignoriert werden kann, haben wir eine Chance. Dazu müssten aber auch die Gewerkschaften endlich etwas aktiver werden. Der international beachtete Streik an der Charité ist ein leuchtendes Beispiel. In diesem Sinne sollten wir daran arbeiten, die Bürger in unseren Ländern und die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren. Es geht nämlich auch anders. Ein Grund für die Unterstützung Kubas ist ja auch, dass dort Medikamente günstiger abgegeben werden, als es im Westen die Pharmaindustrie zulässt.
Können Europäer sich sonst noch etwas vom kubanischen Gesundheitssystem abgucken?
Kuba hat die höchste Lebenserwartung in Lateinamerika, und die Kindersterblichkeit bei Neugeborenen ist in Kuba niedriger als in den USA. Ein Grund dafür ist die unterschiedliche Struktur der Gesundheitssysteme. In Kuba ist ein Familienarzt für etwa 1.000 Personen verantwortlich. Er muss jeden mindestens einmal pro Jahr persönlich untersuchen. Wenn Leute nicht zum Arzt kommen, geht er zu ihnen. Als nächste Stufe gibt es flächendeckend Polikliniken, dann die größeren Krankenhäuser und spezielle Institute wie das IPK oder andere. Grundlage ist aber die Primärmedizin, also der Hausarzt. Wenn die Primärmedizin nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Sie ist für die Lebensqualität und die Lebenserwartung entscheidend. In den Entwicklungsländern sind wir von vergleichbaren Standards weit entfernt. Und in Europa werden immer mehr Mediziner Fachärzte, weil sie dann besser verdienen. Doch dadurch wird die Grundversorgung immer schlechter. Das Netz der primären Versorgung sollten wir uns von Kuba abgucken. Das würde auch helfen, hier die Kosten zu senken.
Zum Abschluss etwas Persönliches. Sie haben Ihr Gehalt als Chefarzt auf 200.000 Franken pro Jahr begrenzt, was Ihnen mehr Ärger als Ihr Engagement für Kuba eingebracht hat. Sind Sie Marxist, wie Ihnen Kritiker vorwerfen?
Das Denken in marxistischen Kategorien sehe ich nicht als Vorwurf. Ich habe die Klassiker gelesen, aber auch Gramsci, und ich denke wie er, dass wir Alternativen in der Gesellschaft aufbauen müssen. Marx ist neben Darwin und Freud einer jener Wissenschaftler, die meine Weltanschauung am meisten geprägt haben.
Franco Cavalli … ist einer der renommiertesten Krebsforscher der Schweiz und Präsident von Medicuba Europa. Die Organisation trägt seit rund 20 Jahren zur Erhaltung und Erneuerung von Gesundheitseinrichtungen in Kuba bei. Der Professor und ehemalige Chefarzt für Onkologie im Spital Bellinzona (Tessin) gehört zum linken Flügel der Sozialistischen Partei der Schweiz und war von 1995 bis 2007 deren Vertreter im Nationalrat
|
Veröffentlichung |
Interview: Volker Hermsdorf
junge Welt, 29.04.2017