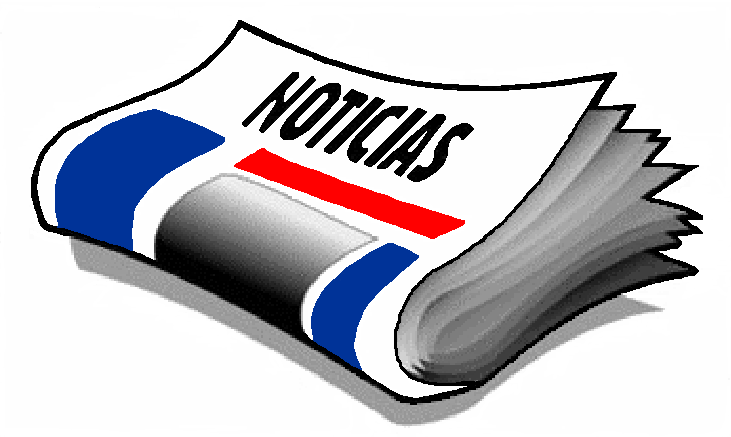
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
Mumia Abu-Jamal: Profit vor Gesundheit
Seit dem Tod von Thomas Duncan, der am 20. September aus dem westafrikanischen Liberia nach Dallas, Texas, geflogen war und kurz nach der Ankunft mit Ebola-Symptomen ein Krankenhaus aufgesucht hatte, bestimmt die »Ebola-Krise« die Schlagzeilen der US-Medien. Sie erzeugt tiefgehende Ängste und schürt Fremdenfeindlichkeit. Es ist keine Frage, dass vom Ebola-Fieber eine große Gefahr ausgeht, weil die Erkrankung in 70 Prozent der Fälle tödlich verläuft. Das Ebola-Fieber ist nach einem Fluss in der Republik Kongo benannt, wo es 1976 zum ersten Mal auftrat. Es wird auch als »hämorrhagisches Fieber« bezeichnet.
Um keine größeren Ängste in der Bevölkerung auszulösen, wird die Bedrohung, die von diesem Virus ausgeht, von den Offiziellen heruntergespielt. Oftmals haben sie zur Bekämpfung der Epidemie selbst nicht mehr zu bieten als die trügerische Hoffnung auf Besserung. Diese eher auf Symbolik als auf reale Lösungen setzende Politik verfügt nur über schwache Gegenmittel gegen eine ernsthafte Bedrohung durch Viren, Seuchen und Tod. Deshalb haben wir es hier eigentlich nicht mit einer »Ebola-Krise« zu tun, sondern mit der Krise des US-Gesundheitssystems, dem ein fragwürdiges Geschäftsmodell zugrunde liegt. Ihm geht nämlich der Profit über alles, auch über den Schutz des Lebens. Man muss sich das nur noch einmal vor Augen führen: Als Duncan hilfesuchend das Texas Health Presbyterian Hospital in Dallas betrat, wurde er von einer Angestellten, die man dort »Screener« nennt, befragt. Sie schickte ihn mit einem Antibiotikum nach Hause. Diese Person war kaum medizinisch geschult und hatte nur die Aufgabe, Patienten in Empfang zu nehmen und ihre Beschwerden in einem Fragebogen zu erfassen. Mit Sicherheit gehört sie nach den Reinigungskräften zu den am schlechtesten bezahlten Beschäftigten des Krankenhauses.Diesem privatwirtschaftlich orientierten Geschäftsmodell folgen heutzutage die meisten Gesundheitseinrichtungen in den USA. Es erweist sich immer wieder als ineffektiv, gefährlich und alles andere als gesundheitsbewusst. Ursache dafür ist eine unternehmerische Entscheidung, deren erster Grundsatz Profitabilität ist und nicht der Schutz des Lebens.
Die aktuelle Krise hat auch gezeigt, wie gefährdet das Pflegepersonal in diesem System ist. Betriebswirtschaftlich gesehen sind Pflegekräfte weniger wert als Ärzte. Sie werden schlechter bezahlt, ausgebildet und geschützt, dürfen dafür aber mehr arbeiten. Wer verbringt denn mehr Zeit mit den kranken Patienten – Ärzte oder Pflegepersonal? Und wer hat den engsten physischen Kontakt mit den Patienten? Wie berichtet wurde, war die Sicherheitskleidung des Ebola-Pflegepersonals in Dallas im Halsbereich undicht. Als sich die Pflegekräfte darüber beschwerten, empfahl man ihnen, diese Stellen mit Klebeband abzudecken. Diesem Gesundheitssystem geht es in erster Linie um die Sicherung von Profit und Ansehen, nicht jedoch um den Schutz der Menschen. Ärzte erhalten den besten Schutz, Pflegekräfte den schlechtesten.
Als das Ebola-Fieber in Westafrika ausbrach, machte die US-Regierung zuerst Soldaten als Hilfskräfte marschbereit. Die Republik Kuba hingegen, die über eine hochentwickelte biotechnologische und medizinische Expertise bei Tropenkrankheiten verfügt, entsandte 165 Ärzte und Pflegekräfte nach Sierra Leone. In Vorbereitung ist der Einsatz weiterer Mediziner in Liberia und Guinea, so dass insgesamt 461 Ärzte, Pflege- und Laborkräfte zur Behandlung und Heilung von Ebola-Patienten nach Westafrika reisen werden. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass »15.000 kubanische Fachleute für den Kampf gegen Ebola bereitstehen«. Das kleine sozialistische Kuba hat im Laufe der Jahre über 325.000 Fachleute seines Gesundheitswesens in 158 Länder dieser Erde geschickt, mehr als die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Kubas medizinische Fakultät in Havanna bildet unentgeltlich Tausende Medizinstudenten aus allen Teilen der Welt aus, die sich die teure Ausbildung in ihren Heimatländern nicht leisten können. Das sieht nicht gerade nach einem lukrativen Geschäftsmodell aus, ist aber ein verdammt gutes Modell einer am Menschen orientierten Gesundheitspolitik.
Übersetzung: Jürgen Heiser
|
Veröffentlichung |
Mumia Abu-Jamal
junge Welt, 19.10.2014