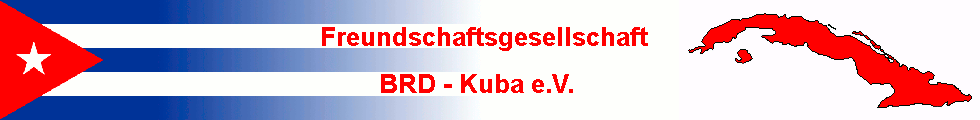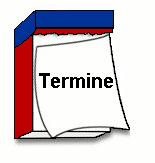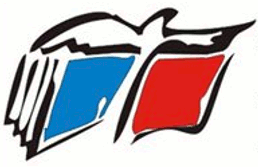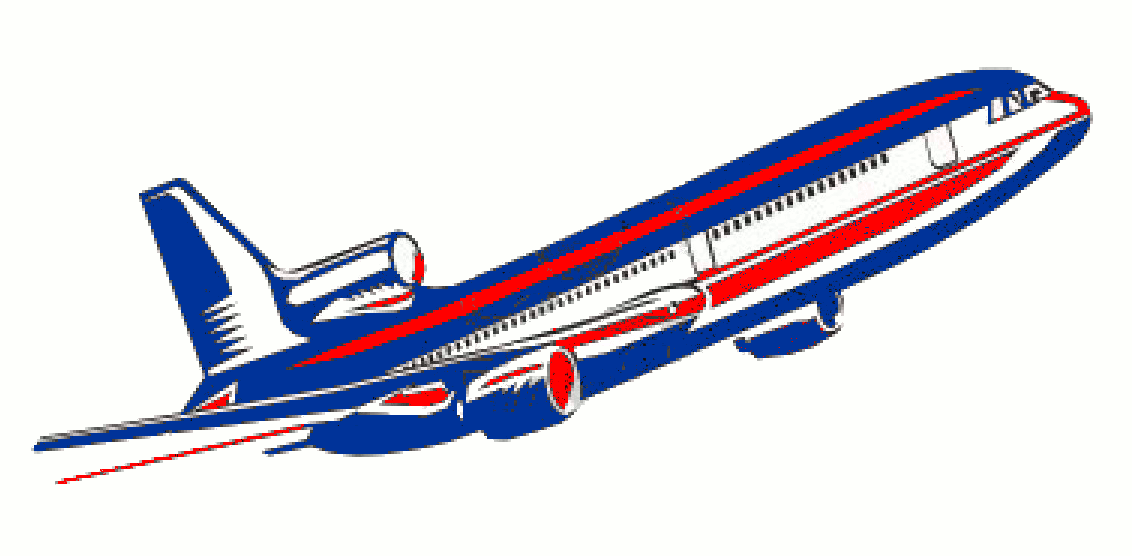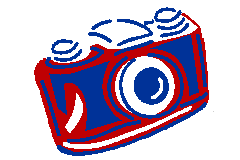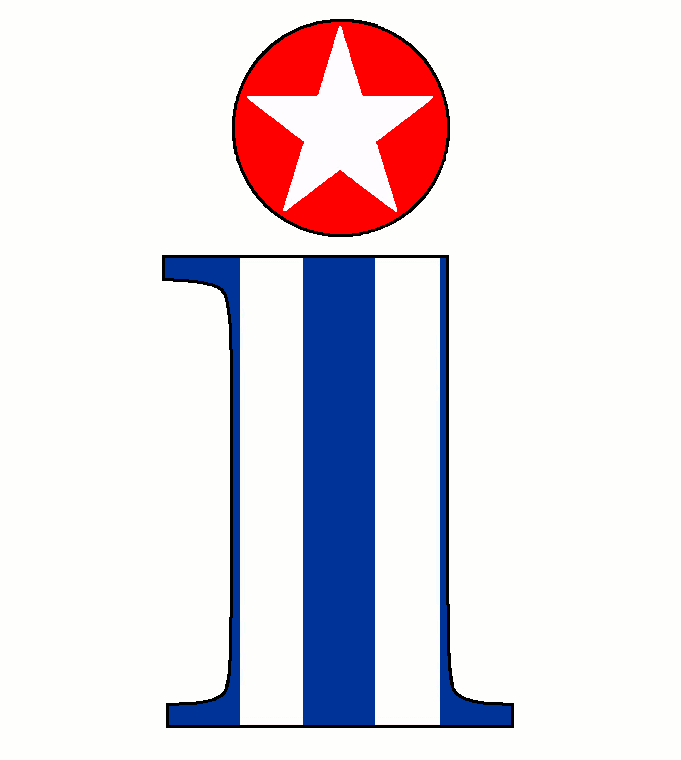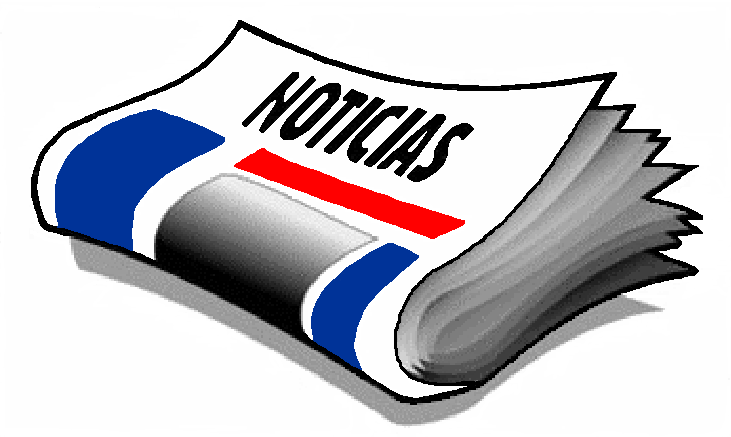
Nachrichten aus und über Kuba
Nachrichten, Berichte, Reportagen zu aktuellen Entwicklungen, Hintergründen und Ereignissen in Kuba, internationale Beziehungen und der Solidarität mit Kuba.
»Militärische Gefahr ist geringer«
Wirtschaftsreformen und politische Korrekturen auf Kuba: Es gibt langsames Wachstum, aber auch verheerende Rückschläge wie durch den Wirbelsturm »Sandy«. Ein Gespräch mit Hans Modrow
Hans Modrow (geb. 1928) arbeitete nach seiner Kriegsgefangenenschaft in der Sowjetunion in FDJ und SED. Von November 1989 bis März 1990 war er Ministerpräsident der DDR
Sie sind wie alle Deutschen: Wenn es hier trübe und kalt wird, fährt man in die Sonne. Sie kommen gerade aus Kuba zurück.
Eben. Nach dieser Lesart hätte ich ja bleiben müssen. Aber Scherz beiseite: Ich war schon vor geraumer Zeit vom ZK der KP Kubas in meiner Funktion als Vorsitzender des Ältestenrates zu politischen Gesprächen eingeladen worden, und die habe ich nun zwischen dem 18. und 28. November geführt. Dabei hat mich Dietmar Schulz begleitet, der im Parteivorstand der Linken in der Abteilung für internationale Beziehungen tätig ist.
Es war also eine Reise in politischer Mission?
Nun ja, wir hatten Grüße des Ko-Vorsitzenden Bernd Riexinger an die kubanische Partei und die Nachricht zu überbringen, daß er frühestens nach den Bundestagswahlen im Herbst 2013 nach Havanna kommen werde.
Und sonst?
In erster Linie ging es darum, uns ein Bild von den Veränderungen zu machen, die es seit 2008, seit dem Amtsantritt von Raúl Castro, gibt.
Sie waren damals, 2008, letztmalig auf der Insel. Der wievielte Besuch war dieser?
Ich glaube, mein siebter. Zum ersten Mal war ich 1970 dort. Jeder Besuch bringt mir aber die Kuba-Krise des Jahres 1962 in Erinnerung, als die militärische Konfrontation der beiden Großmächte die Welt an den Rand eines Kernwaffenkrieges brachte.
Die Existenz des Landes ist heute sicherer?
Sagen wir so: Die militärische Gefährdung ist vielleicht geringer, die wirtschaftliche, und damit die politische Lage erkennbar besser als noch vor vier Jahren. Da hat sich merklich einiges entwickelt, die so genannte Sonderperiode, die nach dem Untergang der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers anbrach, geht aber wohl erst jetzt zu Ende. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, mit politischen Funktionären und mit einfachen Leuten. Sie sagten deutlich: Vor einigen Jahren ging es um die Sicherung unserer nackten Existenz, heute gibt es relativ viel zu kaufen. Mit Peso, aber insbesondere mit CUC, jenem an den Dollar gekoppelten Peso Convertible, den man in der Bank kaufen kann. Ein CUC kostet etwa 24 bis 26 kubanische Peso.
In der DDR bekam man für Westgeld auch alles …
Das ist nicht miteinander vergleichbar. Es muß schließlich erst einmal etwas physisch da sein, wenn man es erwerben will. Wenn die einheimische Produktion lahmt und Embargos Importe verhindern, kann man auch mit der härtesten Währung der Welt nichts kaufen. Kubas Wirtschaft wächst, wenngleich langsam. Allerdings wurden die Zuwächse der letzten drei Jahre kürzlich vom Hurrikan »Sandy« aufgezehrt. Nicht nur in New York und an der Ostküste der USA waren die Schäden groß, auch in Kuba gab es eine Katastrophe. Doch davon hörte und las man bei uns nichts. Auf etwa 100.000 Hektar wurde die Ernte vernichtet, man spricht von etwa 13.000 Tonnen Lebensmitteln, die verloren gingen. Ein deutlicher Rückschlag bei den Bemühungen, die landwirtschaftliche Produktion so zu steigern, daß man zum Selbstversorger wird. Allein 2011 mußten noch Waren für 1,7 Milliarden US-Dollar auf dem Weltmarkt gekauft werden, das waren zwei Drittel der benötigten Lebensmittel.
Zur Unglücksbilanz gehörten in der Provinz Santiago de Cuba 46.000 zerstörte und beschädigte Häuser.
Man sagte mir, daß im ganzen Lande etwa 230.000 Wohnungen gelitten hätten. Auf der anderen Seite gibt es auch internationale Hilfe. Als wir in Havanna eintrafen, landete gerade eine chinesische Maschine mit Hilfsgütern. Auch Rußland zeigt sich solidarisch, nicht zu reden von Venezuela.
Rußland?
Ja. Nachdem man einst die Kontakte abbrach, ist Putin dabei, sie zu reanimieren. Dabei spielen gewiß globale strategische Interessen und Pläne eine Rolle. Peking hingegen setzt die Beziehungen zwischen zwei sozialistischen Staaten fort. Und die links orientierten lateinamerikanischen Staaten, allen voran Venezuela, stehen an Kubas Seite im Wissen darum: Wenn Kuba fällt, sind wir die nächsten. Man will nie wieder Hinterhof der USA werden.
Soweit ich aber höre, spricht man in Kuba nicht vom Sozialismus im 21. Jahrhunderts, wie man es etwa in Venezuela tut.
Kuba, so sagte man mir, habe aus seinen Fehlern gelernt und sucht nach seinem eigenen Weg zum Sozialismus. Dafür gibt es kein Vorbild und auch kein Modell. Weder in Asien heute noch in Europa gestern. Es gibt elf Millionen Kubaner, die Insel ist so groß wie die DDR. Man hat insbesondere in der Sonderperiode unter wahrlich schwersten Bedingungen die Existenz des Landes behauptet. Das hat einerseits das Selbstbewußtsein gestärkt, andererseits auch die Defizite offenbart, die nun mit Wirtschaftsreformen und politischen Korrekturen überwunden werden sollen.
Den Handel sprachen Sie bereits an.
Wenn man durch die Altstadt von Havanna geht, fallen die vielen kleinen Geschäfte und Restaurants auf. Das ist neu. Ich mache es mal konkret. Es werden jetzt überall brachliegende Flächen zur Nutzung in den Kommunen für den Gemüseanbau vergeben. Wir besuchten auch eine Kooperative in Havanna. Der Chef war ein pensionierter Oberst der Armee, Mitte 60 etwa. Er bewirtschaftet mit rund 20 Angestellten drei bis vier Hektar und verkauft an zwei Ständen. 15 Prozent seiner Einnahmen muß er an den Staat abführen, das ist alles. Die Gehälter sind gut, die er zahlt. Unsere Dolmetscherin sagte neidvoll, sie seien dreimal so hoch wie ihr Gehalt. Einzige Bedingung: Wer nicht ordentlich arbeitet, muß gehen.
Das ist übrigens ein gesellschaftliches Problem. Aus den Verwaltungen sollen etwa 700.000 Angestellte ausscheiden, mancher sprach sogar von etwa einer Million, die freigesetzt werden sollen. Das heißt: Die sehr bürokratische Verwaltungsarbeit soll dadurch objektiv besser werden, denn es bleibt nur der, der kompetent und effizient arbeitet. Die Freigesetzten müssen auf den Arbeitsmarkt, der sich erst zu entwickeln beginnt. Dieser Übergang soll aber mit Unterstützung der Gewerkschaft sozial und sanft, nicht abrupt erfolgen. Keine Schocktherapie wie etwa in Rußland oder in Ostdeutschland, es soll ja auch kein Systemwechsel erfolgen. Aber es ist ein prinzipielles Umdenken zu erkennen. Ein Posten ist keine Lebensstellung, man muß ihn mit Engagement und Sachkenntnis behaupten.
Ein prinzipielles Umdenken hat auch bezüglich der Subventionen eingesetzt, woran in der DDR nicht zu denken war.
Richtig. Es werden nicht mehr pauschal Waren subventioniert, sondern Familien etwa mit Sozialbeihilfen unterstützt. Dabei geht es nicht nur um den effektiven Einsatz staatlicher Mittel, sondern auch um ein demographisches Problem. Kuba ist das einzige Land in Lateinamerika mit sinkender Bevölkerungszahl, es werden einfach zu wenig Kinder geboren. Laut Statistik sind es 1,6 pro Frau, es müßten aber 2,1 sein, um die Bevölkerungszahl langfristig zu halten. Zu den Maßnahmen, die hier wirken sollen, gehört auch der Wohnungsbau. Als wir über Land fuhren, sahen wir überall kleine Häuschen entstehen. Wenn man früher jemanden sah, der privat werkelte, dann wußte man: Das Baumaterial war nicht ehrlich erworben. Inzwischen gibt es das zu kaufen. Das Land, auf dem das Haus steht, bleibt Eigentum des Staates. Man kann bis maximal 64 Hektar nutzen, um darauf Landwirtschaft zu betreiben und darf auch sein Haus und Wirtschaftsgebäude darauf bauen. Es liegen noch unendlich viele Flächen brach, die auf diese Weise für die Produktion erschlossen werden sollen.
Aber es gibt nach wie vor die »Libreta«, jenes Büchlein, in dem die Zuteilung an Lebensmitteln pro Person ausgewiesen ist und auf die man Anspruch hat.
Dieses im Frühjahr 1962 eingeführte Verteilungssystem, mit dem bei sinkendem Warenangebot für Gerechtigkeit gesorgt wurde, soll nach und nach abgeschafft werden. Eben wie die Subventionen – man spricht von etwa einer Milliarde Dollar pro Jahr, die dafür ausgegeben werden. Die ihrerseits wieder für Ungerechtigkeit sorgten: Von den staatlich gesicherten niedrigen Preisen profitierten Arme wie Besserverdienende gleichermaßen. Diese Gleichmacherei soll überwunden werden.
Kuba setzt also auf Wachstum, sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft. Dafür braucht man Anreize. Wir setzten seinerzeit auf den »sozialistischen Wettbewerb«, was nicht unbedingt funktionierte.
Sie setzen vor allem auf kleine unternehmerische Freiheiten, die mehr als ein Drittel der Wirtschaft erfassen könnte. Den etwa 2.000 Genossenschaftsbetrieben in der Landwirtschaft beispielsweise gewährt man mehr betriebswirtschaftliche Autonomie. Sie können »freie Spitzen« selber verkaufen, um damit etwa Baumaterial zu kaufen usw. Und auch eine Solidaritätsorganisation wie Cuba Sí hat sich darauf mit ihren Projekten eingestellt, was man dankbar registrierte. Wir waren im Valle del Perú, wo mit Spendenmitteln von Cuba Sí ein Vorhaben zur Milchproduktion gefördert wird. Das stärkt die Kooperation, was auch hierzulande Beachtung finden sollte.
Ist diese Politik nicht eine Kritik an Fidel Castro?
Überhaupt nicht. Man sagt, viele Ideen hat Fidel schon früher gehabt, sein Bruder Raúl ist dabei, sie umzusetzen. Beide sind öffentlich auch kaum noch im Stadtbild präsent. Die Zentralfigur ist Ché Guevara, um deutlich zu machen, daß es um die Fortsetzung des mit ihm begonnenen revolutionären Prozesses geht. Selbst das aktuelle Reisegesetz ist im Grundsatz nicht neu, wurde mir versichert. Künstler konnten schon immer bis zu elf Monaten ausreisen und sich in der Welt umschauen. Es gab auch die Möglichkeit einer Verlängerung. Wer sie jedoch nicht einholte, verlor die Staatsbürgerschaft. Diese Reisemöglichkeit räumt man nun auch breiten Bevölkerungsteilen ein.
Trotzdem bleibt doch das Problem, daß vor allem Jugendliche ihrer Heimat den Rücken kehren?
Nach meiner Wahrnehmung gibt es bei den meisten jungen Kubanern eine starke Bindung an die Heimat. Außerdem sagten mir meine Gesprächspartner, daß sie auch Risiken eingehen müßten. Und keineswegs atypisch war die Bemerkung des Oberst a. D. im Stadtgarten. Seine Tochter lebt in Italien. Er muß ihr Geld schicken, damit sie dort existieren kann. Sie wird – wie so viele Kubaner, die den heutigen Kapitalismus erstmals in seiner Totalität erleben – wieder nach Hause kommen.
Ihr Fazit der Reise?
Immer wieder wurde betont: Wir gehen schrittweise vor, wir analysieren ständig die festgelegten Pilotprojekte, um zu korrigieren, was nicht mehr erfolgreich läuft. Die Partei hat nicht immer Recht, aber ihre Mitglieder sollen so wirken, daß sie Vertrauen im Volk fördern. Was jetzt beginnt, dürfte die größte Herausforderung in Kubas Geschichte sein.
|
Veröffentlichung |
Interview: Robert Allertz
junge Welt, 04.12.2012