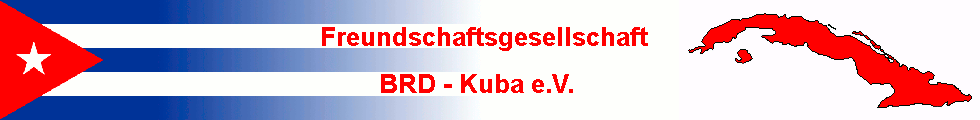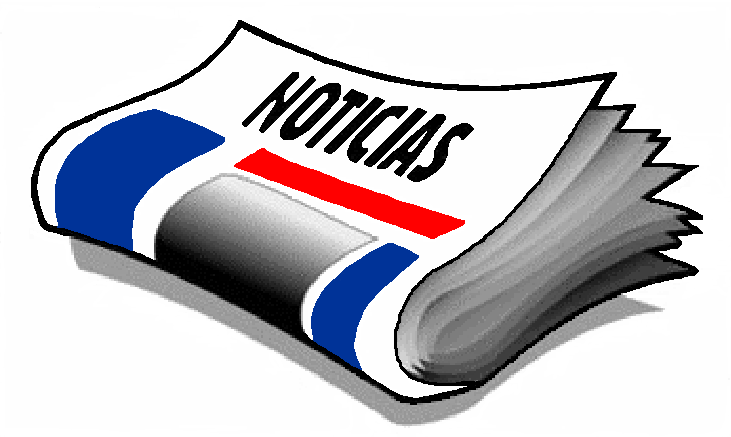Ärzte gegen Ebola
Mit revolutionärer Ethik eine Pflicht erfüllt.
Kubas medizinische Brigade in Liberia ist ein einheitliches Kollektiv. In diesen Tagen haben die Spannungen abgenommen und die Koffer für die Rückreise werden gepackt. Dieses von Sorgen befreite Monrovia ist nicht mehr das, das wir von den ersten Tagen unseres Aufenthalts her kannten. Das Marktgeschrei auf den Hauptstraßen zeugt – paradoxerweise – von Ruhe. Ich rede mit den Ärzten und Pflegern und spreche das an, was sie bereits wissen: In Kuba verfolgte man, was sie taten, und man wartete auf sie. Aber sie wehren sich dagegen, als Helden angesehen zu werden. Viellicht deshalb, weil sie tatsächlich welche sind. An dem Tag, an dem Kuba die Entscheidung verkündet wurde, die in Wirklichkeit eine Entscheidung seiner Männer war, dieser Männer, in die roten Zonen Afrikas zu reisen, wo das Ebla-Virus grassierte, verwandelten wir Kubaner uns in eine einzige Familie. Wir fühlten uns als Eltern, Geschwister oder Kinder und verfolgten ständig die Informationen über ihre Gesundheit, ihre geretteten oder verlorenen Patienten. Ich habe mit fast allen gesprochen und keiner ähnelt dem anderen. Sie sind so verschieden, wie sie in einem Punkt gleich sind: Diese Männer sind Kubaner der Revolution. Ich möchte Ihnen die Aussage des Arztes Leonadro Fernández vorstellen, 3 Jahre alt, Fachmann für Intensivtherapie und Innere Medizin, Experte für medizinische Notfälle und Intensivpflege, Assistenzprofessor der Fakultät für medizinische Wissenschaften von Guantánamo. Ich möchte nur ihn allein sprechen lassen.
"Meine Familie kennt das schon, denn ich habe bereits einige andere Missionen erfüllt. Außerdem teilen wir die gleichen Werte. Es ist eine kleine Familie und durchweg revolutionär: Frau und zwei Kinder, eine Tante, zwei Onkel. Meine Frau ist pensioniert. Eine meiner Töchter ist in klinischer Laborarbeit graduiert. Sie war auf einer Mission in Venezuela. Mein Sohn ist Krankenwagenfahrer. Eine kleine Familie, aber sie ist vereint."
Mit Furcht, aber mutig
"Ich glaube an die Jugend. Wie könnte ich auch nicht? Jugend bedeutet Veränderung, Revolution. Ich sage den Jüngeren unter meinen Compañeros: Ich kann nicht so denken wie Ihr. Ich wurde in einer anderen Zeit, einer anderen Epoche mit anderen Notwendigkeiten geboren. Heute gibt es andere Visionen, mehr Möglichkeiten. Jugend ist Wandel. Was wir tun müssen, ist Werte Formen, Prinzipien. Die meisten Brigadisten sind junge Leute. Wir Alten sind nur vier oder fünf. Und sie waren sehr mutig, vor allem die Pfleger, und haben mit großer Intensität gearbeitet, mit Furcht zwar, wir alle haben eine enorme Furcht gespürt, vor der Abreise, hier … und haben sie immer noch, denn bis zum letzten Tag kann uns dieses Viech erwischen. Ängstlich, aber mit Mut. Ich glaube, dass die Vorbereitung, die wir in Kuba hatte, sehr gut war, ich würde sagen, entscheidend, weil man uns von Beginn an reinen Wein einschenkte. Man hat uns gesagt, wo wir hinkommen und welche Risiken wir eingehen würden. Wir wurden in Kuba trainiert. Ich bin sehr dankbar für die Vorbereitung durch die WHO, aber das, was man uns in Kuba erzählte, in der Zentrale für Medizinische Zusammenarbeit und im Institut für Tropenmedizin Pedro Kuori, hatte nichts an sich, um das man uns beneidet hätte. Also reiste man von dort mit dem Wissen darüber ab, was einen hier erwartete, mit dem Wissen um die Gefahren, psychologisch und technisch präpariert für das, was wir tun würden. Das war von grundlegender Bedeutung. Uns später hat die Verabschiedung durch den General (die Rede ist von Raúl Castro) alle mit Zuversicht erfüllt."
Zwischen Tragödie und Solidarität
"Als wir ankamen, trafen wir auf ein menschenleeres Land, eine menschenleere Stadt. Es gab fast keine Autos auf den Straßen und keine Menschen. Man sah niemanden. Auch in dem Hotel, wo wir zu Mittag und zu Abend saßen, sah man nur Kubaner und drei Uno-Beamte. Und jetzt, da wir hier sprechen, meine Herren, welch ein Unterschied! So kann man hier mit ein bisschen Stolz weggehen, wenn man sich sagen kann: Ich habe etwas dazu beigetragen, dass diese Stadt wieder voller Menschen ist. Die Leute in den Straßen grüßen uns, wenn wir essen gehen oder etwas kaufen, sie behandeln uns mit unheimlicher Zuneigung. Die Autos halten an, damit die Kubaner die Straße überqueren können.
Unsere Einheit ist nach und nach gewachsen. In der ersten Woche hatten wir schreckliche angst, aber je mehr Zeit verging, desto mehr musste man schon einige bremsen, denn sie wollten mehr tun, als man uns zu tun gebeten hatte. Wir sahen ganze Familien sterben, Kinder, die allein zurückblieben, Mama, Papa, die drei Geschwisterchen gestorben, schrecklich … aber wir sahen auch, wie andere, die Ebola überlebt hatten, diese schutzlosen Kinder aufsammelten und aufnahmen. Es gibt keinen schöneren Lohn, als diese Solidarität unter den Liberianern zu sehen. Wir sind unter dem Prinzip der Freiwilligkeit hierhin gegangen und in keinem Augenblick wurde in Kuba über eine Vergütung für uns gesprochen. Sie kamen zu meinem Krankenhaus und fragten, wer bereit sei zu gehen. Sie sagten uns, es könnte sein, dass wir nicht zurückkehren, und ich habe meine Hand gehoben. Keiner hat uns gesagt, wir werden dir so und so viel bezahlen oder dir dies oder das geben, obwohl es das ist, was viele Leute glauben."
Sich als Held fühlen?
"Sieh mal, die Medienpräsenz dieser Mission, die Propaganda, die über Facebook lief, über das Internet, hat dazu geführt, dass einige von uns geglaubt haben, etwas Außerordentliches getan zu haben und sich als Helden gesehen haben. Ich denke, dass wir mit einer revolutionären und medizinischen Ethik eine Pflicht erfüllt haben. Was für einen Unterschied gibt es zwischen uns und denen, die sich im brasilianischen Urwald befinden?
Welcher Unterschied besteht zwischen uns und denen im Urwald von Venezuela, die sich monatelang allein in indigenen Gemeinden aufhalten, oder denen in den Dörfern Afrikas?
Ich z.B. habe in der Hauptstadt von Mosambik gewohnt und dort auf der Intensivstation gearbeitet, aber es gab Kollegen, die an der Grenze, im Urwald mit Temperaturen von 48 Grad, gelebt haben … Worin besteht der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass dies hier international gesehen eine sehr bekannte Mission war, die in den Medien erschien und deshalb die Bedeutung bekam, die sie hatte; denn es ist wahr, man muss schon allem Mut zusammennehmen, um zu sagen: Ich gehe jetzt dahin und stelle mich dem. Das ist nicht zu bestreiten, aber es ist einfach eine Aufgabe mehr.
Uns, die wir uns bereiterklärt haben, dorthin zu gehen, genügt die Anerkennung, und dass unser Volk von uns spricht, das ist die höchste Anerkennung für uns. Wenn sich einmal etwas Materielles daraus ergibt, so ist es willkommen, denn unsere Bedürfnisse sind nicht alle erfüllt, aber es ist nicht so, dass ich glaube, es zu verdienen, dass sie mir etwas geben müssen. Die Fünf waren 16 Jahre im Gefängnis und haben keinen Moment an so etwas gedacht.
Die Leute brauchen Menschen, die Vorbilder sind. Ich habe das Glück gehabt und bin stolz darauf, Vilma und auch Raúl persönlich zu kennen. Mit Fidel bin ich drei oder vier Mal zusammengetroffen, so wie mit Ihnen jetzt. Das sind wirkliche Helden und ich kann nicht erkennen, dass sie von Ihrem Heldentum, ihrem Mut sprechen. Damit man respektiert wird, muss man sich nicht als Held fühlen. Was mit allerdings etwas bedeutet, ist, wenn man anerkennt, dass ich ein wahrer Revolutionär bin, der fest zu seinen Prinzipien steht. Das genügt. Und davon gibt es in Kuba viele, sehr viele. Die, die jeden Tag um 12 Uhr nachts aufstehen, das Brot machen, das ich morgens esse, diejenigen, die über Jahrzehnte hinweg Zuckerrohr geschlagen haben, damit wir etwas zu essen hatten, das sind zweifellos Helden."
Ich hebe meine Hand und danach frage ich, wohin es geht
"Ich habe 1979 eine Mission in Nicaragua durchgeführt, als dort die Revolution siegte. Das geschah am 19. Juli und am 17. August kam die erste Brigade. Dort war ich bis 1981 in Puerto Cabezas, an der Atlantikküste. (…) Als ich bei dem ALBA-Treffen war, hat es mich sehr bewegt, dass Daniel (Ortega) mich am Ende umarmt hat. In Nicaragua bin ich richtig zum Revolutionär geworden. Als ich 17 Jahre alt war, konnte man kein Lied der Beatles hören und weder in ein Lokal gehen, noch spät am Abend auf der Straße sein. Obwohl meine Familie zur Bewegung des 26. Juli gehört hatte und mein Vater und meine Schwester in der Sierra gewesen waren, war ich aufmüpfig und habe nichts verstanden. Ich mochte Rockmusik und hatte lange Haare. Aber man hatte mich nach den Prinzipien der Revolution erzogen und als sie mir eines Tages sagten: 'Es gibt diese Situation …', da gab ich mir einen Ruck und hob meine Hand. Ich lernte Kuba schätzen, als ich außerhalb Kubas war. Danach habe ich mich aber nicht in diese Freiwilligenbörse eingeschrieben, es erschien mir absurd. Das blieb so, bis Fidel nach dem Hurrikan Katrina die Ärzte dazu aufrief, nach New Orleans zu gehen. Ich war unter den ersten 150, die ausgewählt wurden. Später wuchs die Brigade bis auf 1.500 an. Am ende sind wir aus verschiedenen Gründen nicht in die Vereinigten Staaten gegangen. Aber Fidel rief uns zu einer Veranstaltung in der Ciudad Deportiva (Sportzentrum) zusammen, die mir immer im Gedächtnis bleiben wird. Dann kam es zum Erdbeben in Pakistan und zu den Überschwemmungen in Mexiko und Guatemala. Die Brigade teilte sich auf. Mir fiel es zu, nach Pakistan zu gehen. Nach dieser Mission erbat Bruno Rodríguez um meine Bereitschaft, direkt nach Osttimor weiterzufliegen. Ich gehört zu jenen, die dachten, dass es nicht eintreffen würde, da ich ja schon auf dem Weg nach Kuba war, und wurde ausgewählt. In Osttimor war ich dann zwei Jahre. Danach geschah das Erdbeben in Haiti und als sie nach Freiwilligen fragten, hob ich meine Hand, erst anschließend fragte ich, wozu. Nun gut, das war am 10. oder 11. und am 12. waren wir bereit in Haiti. Dort weihte ich die Intensivtherapie ein, die in einem Zelt untergebracht war. Ich kehrt zurück und zur Belohnung sagten sie mir, ich solle bei einem Kooperationsprojekt arbeiten. Das war mal etwas anderes, denn bis dahin waren meine Missionen immer nur solche im Krieg oder bei Katastrophen gewesen. Uns so war ich von da an drei Jahre in Mosambik.
Kurze Zeit darauf wurde diese Epidemie hier immer stärker. Ich hatte von Ebola sprechen gehört. Ich kenne Afrika, ich hatte hämorraghisches Fieber in Mosambik, also hob ich meine Hand und hier bin ich. Nichts Besonderes, nicht wahr? Das ist das Leben. Solange ich Kraft genug habe und sie mich haben wollen, gehe ich dahin, wo sie mich brauchen."
|
|
Enrique Ubiete Gómez
Granma Internacional, 15.04.2015