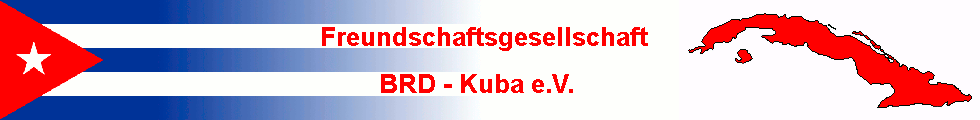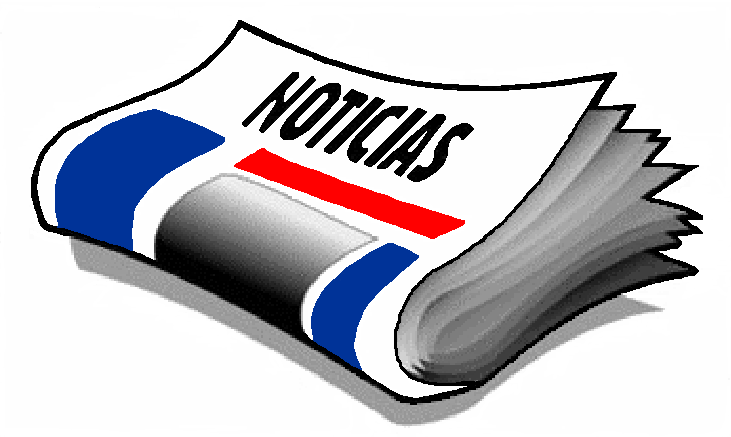»Noch reichlich Arbeit zu leisten«
Die Freundschaftsgesellschaft übt politische Solidarität mit der sozialistischen Macht Kubas.
Gespräch mit Günter Pohl.
Vor 40 Jahren wurde die Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba gegründet. Wie hat sich die Arbeit seither entwickelt?
Die Arbeit hat sich doch merklich verändert. 1974 war die Gründung die Antwort auf den Wunsch nach koordinierter Unterstützung der damals zwar schon gefestigten, aber dennoch unter Druck stehenden Kubanischen Revolution. Gleichzeitig gab es aber noch die sozialistische Staatengemeinschaft, die dem Land in praktischer Hinsicht sicher weit mehr helfen konnte als die vielen Solidaritätsorganisationen, die damals weltweit entstanden. Ab 1990/91 änderte sich durch den Wegfall der UdSSR vieles. Die materielle Solidarität rückte automatisch in den Vordergrund. Darüber hinaus entstanden nach 1990 weitere Solidaritätsgruppen – nicht als Konkurrenz, aber mit Ansätzen, die sich in anderer Weise mit Kuba befaßten.
Die wirtschaftliche Erholung durch die Ausweitung der Außenbeziehungen, vorwiegend nach Lateinamerika, sorgte dafür, daß dann seit etwa 2006 der Schwerpunkt von der materiellen Hilfe wieder auf die politische Unterstützung verlagert wurde. Aber die FG hat auch heute noch fünf Solidaritätsprojekte.
1974 war die FG die einzige derartige Organisation in der Bundesrepublik, heute ist sie nur noch eine von vielen. Was unterscheidet die FG von anderen Vereinigungen, wie zum Beispiel Cuba Sí?
Fast alle der Solidaritätsorganisationen in Deutschland sind Teil des »Netzwerks Cuba«. Darunter sind solche, die ihren Schwerpunkt auf humanitäre Unterstützung legen, andere wiederum organisieren politische Solidarität, andere haben gigantische Mengen an Hilfsgütern in Containern nach Kuba geschickt. Die Solidarität mit dem kubanischen Volk angesichts der anhaltenden Blockade verbindet alle.
Die FG BRD-Kuba, die mit fast 1.000 Mitgliedern größte Kuba-Solidaritätsorganisation, unterscheidet sich von den anderen dadurch, daß sie die sozialistische Macht und die Ausübung der Regierung durch die Kommunistische Partei als Bedingung für die Entwicklung Kubas ansieht. Wir sind aber keine AG einer Partei. Die Mitglieder von »Cuba Sí« machen eine solidarische Arbeit, setzen sich für die »Miami Five« ein und, und, und ...
Aber sie müssen nach meiner Beobachtung in ihrer Partei auch nicht wenige Kämpfe führen, wenn es um eindeutige politische Solidarität mit der Regierung und deren souveränen Entscheidungen geht. In der FG gibt es eine grundsätzliche, klare Haltung dahingehend, daß wir die Souveränität Kubas anerkennen und damit auch Entscheidungen der Regierung. Das schließt die solidarische Diskussion nicht aus.
Kuba ist es in den letzten Jahren gelungen, in Lateinamerika und darüber hinaus Bündnispartner zu gewinnen und eine internationale Zusammenarbeit zu etablieren. Spielt da eine kleine Organisation wie die FG überhaupt noch eine Rolle?
In der Tat ist Kuba erheblich unabhängiger geworden. Das ist gut so, und wir sehen uns mit dem wenigen, was wir von hier aus beisteuern können, in unserer Arbeit bestätigt. Es gibt da keinen Widerspruch. Was aber Kuba in Lateinamerika gelingt, liegt für das Land in den Beziehungen zur EU noch in weiter Ferne. Insofern ist auch für uns noch reichlich politische Arbeit zu leisten.
Viele Freunde des revolutionären Kuba befürchten, daß im Zuge der laufenden Wirtschaftsreformen der Sozialismus auf der Strecke bleibt. Was antworten Sie darauf?
Es ist nicht das erste Mal, daß so etwas befürchtet wird. Klar ist: Selbst für Menschen, die sich viel mit Kuba beschäftigen, erschließen sich nicht alle Maßnahmen immer sofort. Aber wenn in Details sich auch da und dort Fehlentwicklungen vorkamen, so war doch am Ende jede der strategischen Entscheidungen geeignet, den Sozialismus zu erhalten. Wer darüber hinaus gute Ratschläge hat, wie heute Sozialismus verteidigt werden kann, ist herzlich eingeladen, sie der kubanischen Regierung zu übermitteln. Ein Geheimnis des Fortbestands der Revolution über fünfeinhalb Jahrzehnte ist nämlich die Offenheit der Debatte und die Selbstkritik.
|
|
Interview: André Scheer
Junge Welt, 02.10.2014